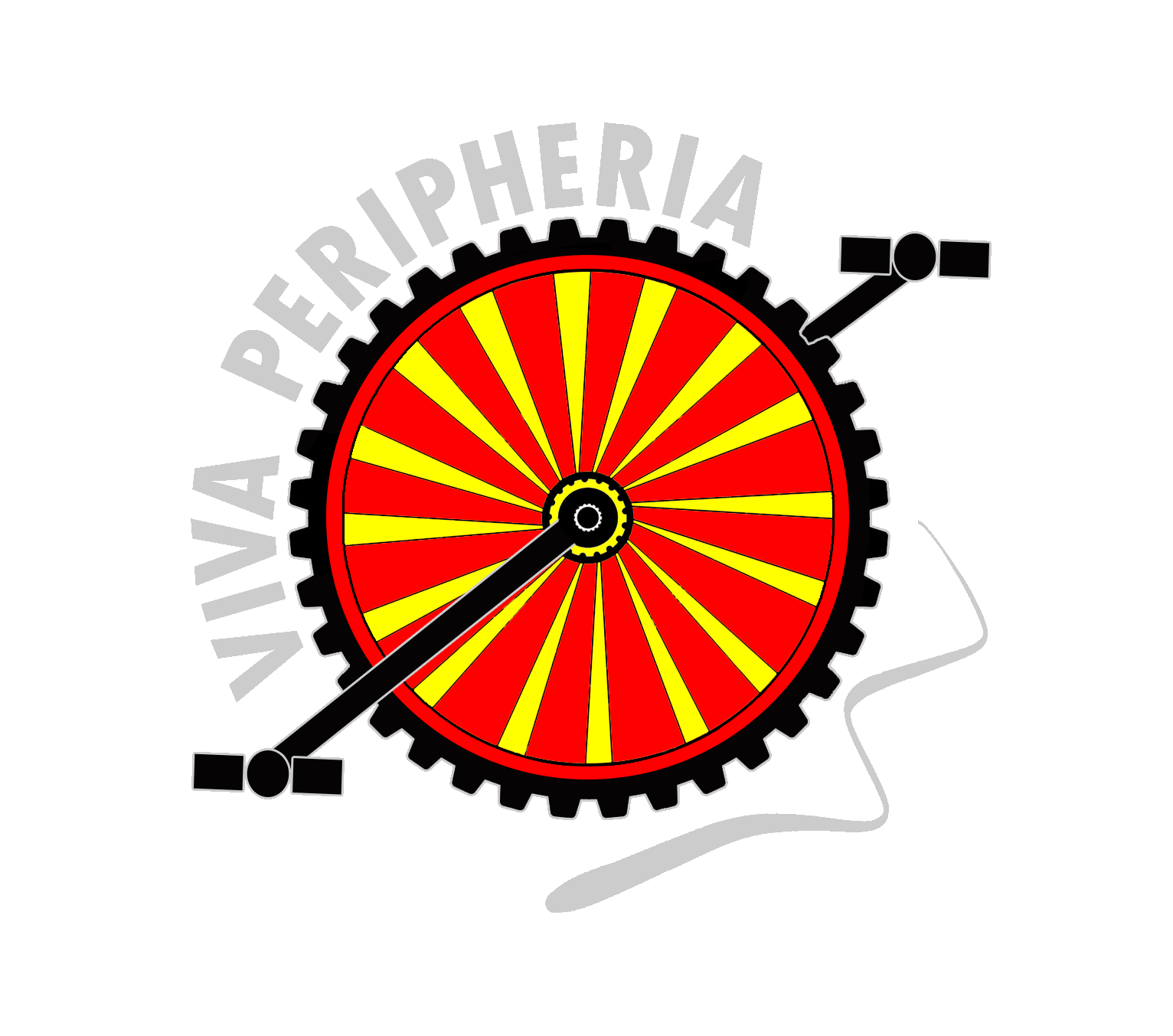Szlak, bzw. szlak turystyczny ist eine Vokabel, mit der man in den Bergen verdammt oft in Berührung kommt. Es handelt sich hierbei, wie ich intuitiv kombinierte, schlicht um den Ausdruck für Wanderweg. Zurück in der Zivilisation wollte dieses, in der Praxis erworbene Wissen, natürlich umgehend überprüft werden. Und siehe, das Wörtchen szlak ist anscheinend ein recht anpassungsfähiger Gefährte. Das Wörterbuch kennt unter dieser Bezeichnung nicht nur Verkehrs- wie Lebenswege sondern auch Luft- und Seestraßen. Doch damit nicht genug. Jauchzenderweise durfte ich lesen, dass es gleichermaßen Bahnstrecke bedeuten kann. Andererseits auch noch (Dekorations)streifen, Spur oder Fährte. Bevor wir’s übersehen: Natürlich fand sich auch das Wörtchen Wanderweg im Übersetzungskatalog. So stolzgeschwellt meine Brust, angesichts der enormen Bedeutungskapazität der Wege auf denen ich wandeln durfte auch war, eine kurzer Abgleich mit einer ausgewiesenen Muttersprachlerin ließ diese Gedankenblase ohne Umschweife zerplatzen. Das Blütenmeer lexikalischer Ergüsse wurde mitleidslos verbrannt und zerstob zu der schlichten Aussage, dass man bei szlak schon überwiegend an eine profane Straße, und in der Regel auch nur an einen Wanderweg denken würde. Das soll mich nun aber auch nicht mehr betrüben als es notwendig wäre sondern vielmehr umso lauter eine Bejubelung der ausgezeichneten Markierung polnischer Wanderwege einleiten. In dieser Beziehung muss eindeutig gesagt werden: Hier hat sich erheblich was getan. Eingangs spruch ich ja meine ersten Polenerfahrungen an. Und ein bedeutender Teil von diesen waren die dilettantisch und grausam angelegten Wanderwege, inklusive ihrer, dem Auge des Suchenden allzu oft entfleuchenden Markierungen. Nichts davon ist mehr aktuell.

Selbstverständlich steht man immer noch an mancher Wegkreuzung verständnislos herum und keckert höhnisch angesichts massiver Mehrfachbeflockungen an schnurgeraden Strecken, doch das geht einem im Schnitt in jedem Land, in dem Wanderwege angelegt sind, irgendwann einmal so. Es muss dagegen herausgehoben werden, dass die Macher der polnischen Wanderwege abseits ihrer Markierungspflege (welche durchaus europäischer Standard geworden ist) einen spürbar hohen Sachverstand bei der Anlage der Wege beweisen. Soll heißen: elegant den Höhenverhältnissen und der Landschaft angeschmiegte Wege anstatt Kiesgrubentransit und Bingoweggabelungen.
Touristen gibt es reichlich in den polnischen Bergen. Achwas, mag da der eine oder andere müde erregt herauskeuchen, doch die Betonung liegt hierbei eben bei dem kleinen Wörtchen „in“. Denn es ist in den Gebirgen Europas alles andere als selbstverständlich, dass sie derart intensiv und artgerecht genutzt werden. Oft sind den meisten Sommerfrischlern allein die besten Lokale und Wellnessangebote des Tals bekannt. Bestenfalls lässte man sich per Auto oder Seilbahn zu einem Fotoshooting auf den prominentesten der vorhandenen Berge hochkarren und das war’s dann. Auf Polens Kämmen und Pässen dagegen zu fast jeder Tageszeit und Witterung ein gar munteres Treiben konstatiert werden. Lustig umherhopsende Schulklassen, lässig geordnete Pfadfindereinheiten, fröhlich einherschreitende Kleinfamilien und souveräne Vollgepäckroutiniers – selbst der unpopulärste Wanderwegzubringer erfreut sich hier vergleichsweise extremster Beliebtheit. Dies erklärte dann auch meine anfängliche Verwunderung über all die Lokale gigantischen Ausmaßes im Tal, welche alle vor Leere zu bersten schienen. Klar, was sollte man sich tagsüber auch in Kneipen rumtreiben wenn der Ruf der Berge so aufreizend im Ohr säuselt.
Uwaga heißt Achtung und könnte gegebenenfalls sogar zum erweiterten Sprachschatz von Polentouristen gehören. Ich muss gestehen, dass ich Uwaga aus dem Grund für diese kleine Impressionsrundschau auswählte, da ich dachte Uwaga stände auf allen Schildern, der von mir reichlich abgelaufenen Grenzwege. Doch da trog mich mein erschlaffendes Mittelstreckengedächtnis.
In Wirklichkeit weiß das, in beruhigendem Gelb grüßende Grenzschild nichts im Sinne Uwagas mitzuteilen. „Staatsgrenze. Überqueren verboten“ ist die lapidare Aussage zu der man sich hier lediglich hinreißen lässt. Kein Ausrufe- oder sonstiges abschreckendes Sonderzeichen. Nichts. Höchstwahrscheinlich überschnitt sich dies dann in meiner Erinnerung mit dem fast ebenso oft gesehenen Warnhinweis der tschechoslowakischen Abgrenzungsmanöver.
Dies könnte mich natürlich jetzt zu wild vor sich hin galoppierenden Schlüssen über Selbstverständnis und Wertung der Polen zu ihren Grenzen führen, aber das soll es nicht. Stattdessen möchte ich die offensichtlich misslungene Assoziationskette unbeeindruckt fortführen und mich über den speziellen Reiz von Grenzwegen auslassen. Auf fast jeden üben Staatsgrenzen von Kindesbeinen an Faszination aus. Die, zuvor mit dem Finger im Atlas oftmals nachgefahrenen markanten Grenzen zwischen Ländern in der Realität nachzuempfinden ist eine originäre Erfahrung. Obwohl man einerseits schnell bemerkt, dass auf dem Boden keine riesige Punkt-Strich-Punkt-Markierung ist, die Gewalten der Natur in jeder Hinsicht unbeinflusst von dieser ausgedachten Barriere sind und selbst alles von Menschen Erschaffene oftmals nicht nach solcherlei Schwellen brachialen Veränderungen unterliegt – dennoch ist es aufregend. Währungen, Sprachen, Gerüche, Farben und Regeln sind mehr oder weniger anders, kurz: Es macht Reisen und Entfernung schubartig spürbarer. Wandert man nun eine solche Grenze in den Bergen ab so ist zuvor beschriebener Widerspruch auf andere Weise erlebbar. Einerseits sind wahrscheinlich nirgendwo anders als in der bergigen Wildnis vom Menschen erdachte Staatsgrenzen so lächerlich wie hier, andererseits sind die mächtigen und nur selten wirklich an Höhe verlierenden Kämme (denn solche werden bevorzugt als Grenzen auserwählt) kraft ihrer Ausstrahlung und Wirkung dann doch irgendwie Grenzen. Man spricht nicht von ungefähr bei großen Flüssen und hohen Gebirgszügen von „natürlichen“ Grenzen. Dass Staaten es sich aber anmaßen, diese zu den Grenzen ihres Herrschaftsgebiets zu erklären steht selbstverständlich auf einem anderen Blatt.
Verbote sind sind in Polen eher als Empfehlungen zu verstehen. Das mag jetzt nicht unbedingt typisch polnisch erscheinen. Außerhalb des preussischen Kultureinflusses und seiner Adepten wird das Verbot als regelnde Negation des öffentlichen Lebens stets mehr oder weniger lax gehandhabt. Doch da es hier um Polen geht, muss es gesondert hervorgehoben werden. Ziehen wir exemplarisch zwei in Polen existierende Verbote heran: das Rauchverbot in Zügen und der Alkoholverzehr im öffentlichen Raum.

Seit dem 1.9. 2007 herrscht in allen Eisenbahnen der EU totales Rauchverbot, also auch in Polen. Doch sogar in der modernsten Zugangsröhre nach Polen, dem Eurocity, ist es kurz hinter der Oder üblich dass man mit erheblich weniger Risiko zwischen den Waggons rauchen kann. Natürlich sollte man das nicht vor den Augen der Schaffner tun, aber man kann sich sicher sein, dass auf jeden Fall der Denunziantentenpegel erheblich gesunken ist. In Zügen niederer Qualität ist auch das Rauchen aus dem geöffneten Zugfenster (geöffnete Zugfenster!!!!) und auf dem ebenfalls vom Rauchverbot betroffenen Bahnhöfen möglich. Das Reglementieren von Saufen im öffentlichen Raum, eine Hydra, die jeder aufmerksame Bundesbürger bedrohlich auf sich zukommen sieht, ist, wie ich anfangs dachte in Polen überhaupt kein Thema. Doch spätestens seit ich irgendwann (die genaue Einführung dieses Gesetzes konnte ich nicht ermitteln) irritiert durch die Bahnhöfe irrte und in keinem Kiosk Bier fand, erkannte ich, dass es wohl doch nicht so einfach sein konnte. Die Lösung dieses merkwürdigen, polenweiten Biernotstands in Bahnhofsnähe war nämlich, dass man ein striktes Verbot des Alkoholverkaufs in allen polnischen Bahnhöfen und deren Umgebung durchgesetzt hatte. Und auch wenn dieses Verbot in den letzten Jahren mehr als ausgehöhlt wurde (man betrachte bei Gelegenheit nur einmal die überreichlichen Kneipengestade, die allein den Wrocławer Bahnhof umspülen!), so spricht dies dann doch eine deutliche Sprache. Man bedenke auch, dass ich von den unterschiedlichsten Eingeborenen immer wieder angstvolle Blicke ernte, wenn ich in einem Park eine Bierflasche aufmache. Ich für meinen Teil erhielt in geschätzten fünf Monaten Polen schließlich noch nie ein Verweis wegen Trinkens in der Öffentlichkeit (abgesehen von der berechenbaren Zurechtweisung auf dem Warschauer Hauptbahnhof, dessen Zeuge ich sein durfte), so besteht offiziell in Polen ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Doch da ich definitiv nicht der einzige bin, der diesbezüglich illegal unterwegs ist, handelt es sich wahrlich um ein schwer zu bemerkendes Gesetz.
Wandern ist natürlich noch eine Sache über die gesprochen werden sollte. Schließlich ist dies ein überaus dehnbarer Begriff. Für den einen mag es sich um eine Wanderung handeln, wenn er sich auf den beschwerlichen Weg aus den Niederungen des Friedricher Hains hinauf in die rauen Lüfte des Prenzlauer Bergs begibt. Der andere versteht darunter die tägliche, kreisförmige Entdeckung seines gewählten Domizils im jeweiligen Urlaubsland. Wieder anderen bedeutet Wandern die völlig von der Zivilisation lösgelöste Grenzerfahrung, immer nah am körperlichen Limit. Dies alles, so könnte man aus den vorigen Einträgen herausgelesen haben, ist es für mich nicht. Ich verstehe unter Wandern die jährliche Rosskur und Kapazitätenregenerierung. Eine Zeit abgeschnitten von sämtlichen Pflichten und Gewohnheiten, die ein Leben in der Stadt und unter Menschen mit sich bringt. Dabei ist der Urschrei auf dem einsamen Gipfel und das abendliche Lagerfeuer unter dem geduldig lauschenden Sternehimmel genauso wichtig wie eine durchzechte Nacht mit den bedenklichen Gestalten einer Dorfkneipe oder die zuckelige, zwischenhaltverwöhnte Reise mit einer Eisenbahn, bei der man noch begreift wie dieses Wort entstanden ist. Auch wenn keinerlei sportlicher Ehrgeiz dabei ist, so brauche ich dennoch die auf Körperkraft basierende Fortbewegung. Wochenlang in der Hängematte zu verbringen (und sei das Plätzchen hierfür auch noch so schön!) wäre mir ein Graus. So lang wie möglich mit nur dem was man auf dem Rücken trägt unterwegs zu sein, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein, dies aber in langsamen, nachvollziehbaren Schritten zu tun und dabei die Einzigartigkeit der Natur zu erleben – das ist für mich Wandern.
Żywiec bildet das Schlusslicht dieser kleinen Aufzählung und dies ist gewissermaßen Tradition, denn auch in den meisten europäischen Enzyklopädien findet sie sich genau an dieser Stelle. Denn wenn man mal kurz mal überschlägt, fallen einem in der Tat recht wenige Worte ein, die dem kleinen Städtchen im alphabetischen Sinne Konkurrenz machen könnten. Doch dies ist zweifellos der einzige Zusammenhang in dem Żywiec an letzter Stelle steht. In einer Beziehung steht Żywiec beispielsweise ganz weit vorn: Im großen Bierstreit Polens. Ein Land, das wie bereits erwähnt, mehr Wodka- als Biersorten hat, muss folgerichtig eine gewaltige Machtkonzentration einiger, großer Biere sein eigen nennen. Tatsächlich gibt es im überregionalen Sinne nur die Großen Fünf (Żywiec, Tyskie, Lech, Tatra und Żubr) wovon die drei Erstgenannten das uneinholbare Triumvirat bilden und die ersten zwei wiederum einen erbitterten Kampf um die Pole(n)position führen.

Ich als relativ unparteiischer Vorkoster muss gestehen, dass ich Tyskie (den derzeitigen Marktführer!) schon ein wenig vorziehe, doch an und für sich handelt es sich schon um geschmacklich recht nahe Verwandte. Beide sind in jedem Fall zu empfehlen. Und mit diesem, mit Sicherheit nicht letzten Tipp, welcher das gar nicht so ferne und doch so oft geschmähte Polen ein wenig näher rücken sollte, schließe ich meine Ausführungen. Die obligatorischen Vorgängerteile:
Entdecke mehr von Viva Peripheria
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.