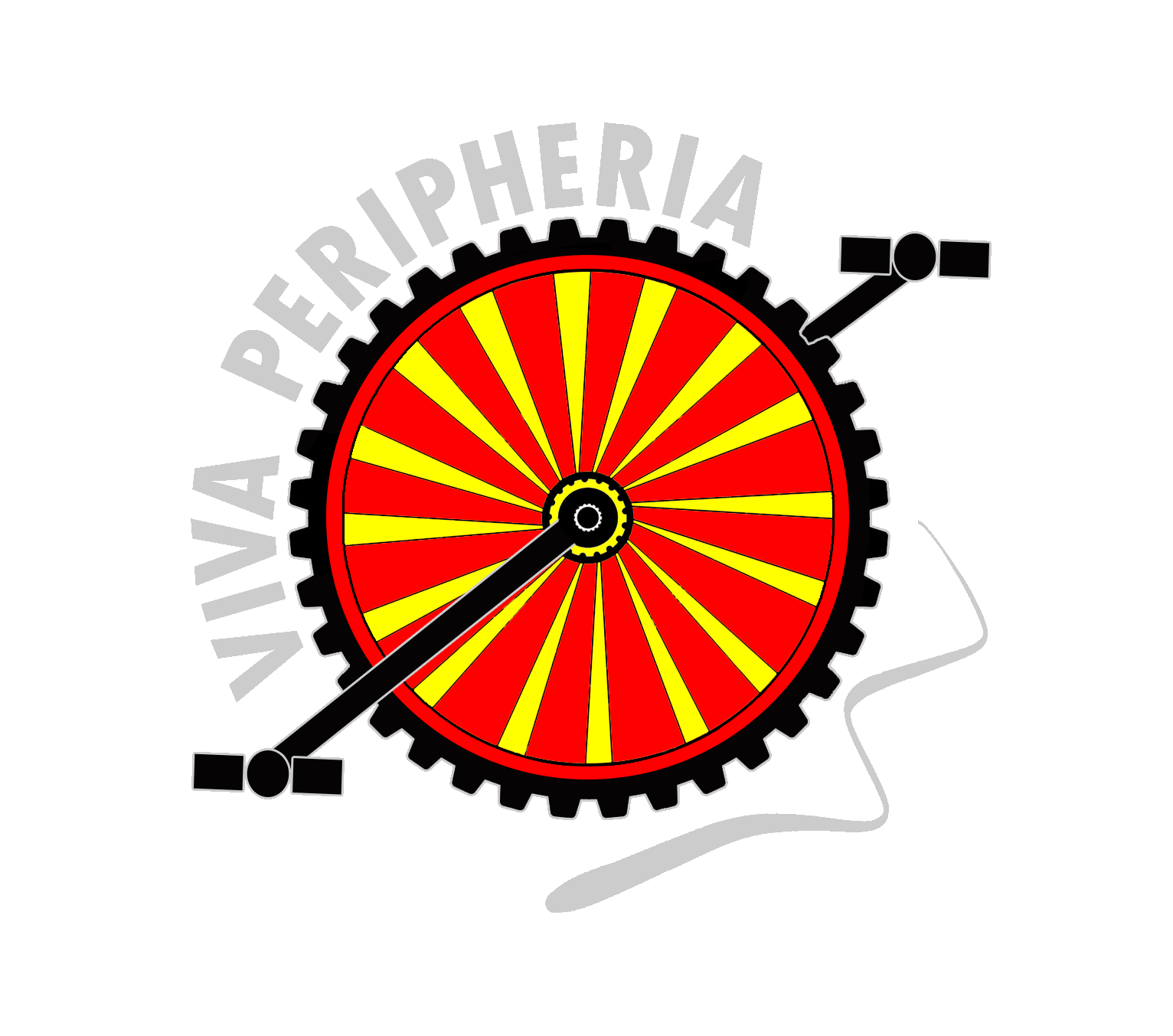Die Stadthitze drückt, der Alltag röchelt gemächlich heran – Zeit für ein kleines Fazit der vergangenen Wochen. Die bereits vorliegende Dokumentation einiger Schlaglichter sollte ja schon angedeutet haben, dass es sich eigentlich um drei Staffeln einer zusammenhängenden Urlaubsserie handelt. Der einsame Charme von Havel und Elbe, der herbe Spaß an der friesischen Nordseeküste sowie die muntere Gazelligkeit im schönen Hollgien.
Wie schon das letzte Mal will ich mich nicht durch chronologische Aneinanderreihung der Geschehnisse befleißigen, sondern hier ein paar Beobachtungen, die mich unterwegs beschäftigt und beeindruckt haben, vertiefen und somit einen hoffentlich etwas unterhaltsameren Eindruck der Radtour in den Goldenen Westen zu offerieren. Außerdem wird mittels der neuen Möglichkeiten der Blogmaschine alsbald eine Auslese der besten Fotos über euch hereinprasseln. Mein Geschwafel unterliegt wie auch jener Urenkel des gefürchteten Mediums – die Diashow – natürlich wie immer der Freiwilligkeit. Daher keine Maulerei ob möglicher Weitschweifigkeit.
Der deutsche Campingplatz oder der tiefere Sinn des Grüßens
Wie nicht anders zu erwarten, war dieser Ausflug sehr an gewisse touristischen Einhegungen angepasst. Auch wenn die Weite der norddeutschen Ebene allzu gern und oft eine unendliche Leere vorgaukeln wollte, die erweiterte Küstenregion von Hamburg bis Brügge ist eine recht lückenlos besiedelte und in fast jeder Hinsicht gut behütete Gegend. Wildzelten oder Lagerfeuerromantik gehörten somit nur äußerst bedingt zum Portfolio der Tour. Deshalb konnte ich meine, in den letzten Sommern schon angeschnupperten Erkenntnisse zum deutschen Camperwesen erheblich vertiefen. Ich möchte es vorwegnehmen, erschlossen hat sich mir diese Geisteshaltung weiterhin nicht, ich kann hier nur beharrlich Beobachtungen hinzufügen, die schließlich irgendwann einmal ein befriedigende Analyse erlauben sollten. Die Nähe des Campers zum Kleingärtner ist so offensichtlich wie verwirrend. Wenn einem das Konzept eines winzigen Fleckchen im Freien (am, auf unabsehbare Zeit, gleichen Ort) angeschlossen an sämtliche Segnungen der Zivilisation behagt, warum, verdammtnochmal, hat man dann keinen Kleingarten?! Eine Frage, von der ich mich dieses Mal nicht aufhalten lassen wollte. Unbefangen ließ ich mich ein auf diese bizarre Welt von frisch gestutzten Rabatten, Schuhregalen im Fond des Caravans und Brötchenvorbestellungsformularen.

Die hervorstechendste Eigenschaft des gemeinen Dauercampers ist wohl seine anerkennunshungrige Art von Freundlichkeit gepaart mit als leger verstandener Offenheit in jener „schönsten Zeit des Jahres“. Er gibt sich locker obwohl er insgeheim schon die Duschmarken abzählt, sie lächeln und belächeln mit einer Grimasse wenn sie mal wieder ein paar von diesen armen, verwirrten Onenightstands angesichtig werden. („Und dann auch noch ohne Auto!“) Doch ich konzentrierte mich auf den schönen Schein und ließ mich, wie gesagt ein auf diese merkwürdige Schattenwelt der Schrebermutanten. Schließlich waren viele ihrer Anlagen nicht nur herausragend gepflegt sondern auch in ihrer Anlage durchdacht, wunderschön gelegen und zumeist gar nicht mal teuer! Ach, und außerhalb vom Meckelbrandischen war es in aller Regelmäßigkeit sogar noch nach 18 Uhr möglich, ein kleines Bierchen zu erwerben. Und dennoch, bereits eine solche Banalität wie Grüßen sollte mir verdeutlichen, dass ich irgendetwas hier grundlegend nicht verstand. Der Campingplatz versprüht in seiner sozialen Vermittlungsinstanz den eines Dorfs, eines gemütlichen allseits vor Kumpeligkeit krachenden Menschelns, dass es nur so eine Art hat. Wenn man sich also morgens zum Klogang herausschält, wird man einmal überrascht, dass man auf dem Weg zum Klo gegrüßt wird, eine zweites Mal, dass man beim Zähneputzen gegrüßt wird. Das dritte zu kreuzende Lebewesen grüßt man daher recht munter, einigermaßen erwacht wie man sich nach diesen reinigenden Minuten langsam fühlt. Doch keine Erwiderung. Irritiert ziehe ich meine Kreise und denke, dass ich wohl noch einige Studien zu dem Homo Campicus unternehmen muss bis ich ihm wirklich auf Augenhöhe begegnen und sein Treiben auch nur annähernd begreifen werde.
Fern dem Zentrum – Die Gemeinsamkeit von Bayern und Friesland
Hach, eine Überschrift von Format, die in der Lage sein sollte, bei manchem mit ätzender Frische Widerspruch und Entsetzen auszulösen. Na dann streck ich mal gelöst auch die zweite Hand ins Wespennest. Ein paar einleitende Worte zu Beginn. Wenn wir ab und an in gelöster Stimmung friedvoll die Füße ausstrecken im Berliner Soziotop dann kommt das Gespräch mitunter auf die große Schar derer im Westen der vereinigten Republik, die laut Umfrage noch nie die Beitrittsgebiete besucht haben (Laut Umfragen nach 25 Jahren immer noch jeder fünfte). Verächtlich witzelnd kuscheln sich über diese Faktenlage jung wie alt, Ostler wie Westler im gemeinsam entdeckten Berlin aneinander und es entsteht jenes wertvolle Gefühl von Überlegenheit der Deutungshoheit, welche aus derlei Lebenserfahrung gewonnen wäre. Doch wie sehen sie meist aus, die Streifzüge, von jenen die sich rühmen, beide Welten zu kennen. Blasse Metropoleneskapaden, Abiturreisen oder hastige Umsteigemanöver. Auch die assimilierten Westler dieser Erfahrungsrunden beziehen ihre Kenntnisse nicht selten aus liebevoll gepflegten Kindheitserinnerungen, Klischees und Abgrenzungsidentitäten. Ich muss es hier einmal in aller Deutlichkeit sagen: Deutschland und seine peripheren Regionen sind für die meisten allenfalls vergilbte Kindheitserinnerungen. Warum auch in Jever mit Uwe und Klaus ein Bier trinken wenn man auf ausgetretenen Backpackerrouten in Bangkok Gutmenschenkolnialismus betreiben kann. Auch ich war frappiert als ich feststellen musste, dass ich schon in Frankreich, Spanien, England und Norwegen in den Atlantik gesprungen bin, aber die deutsche Nordsee nur von Otto-Filmen kannte, dass die bitteren, grünen Flaschen seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten meine Kehle erfreuten, ich aber niemals nur annähernd in der Nähe der Quelle dieses Labsals war.

Umso mehr fieberte ich der Begegnung entgegen. Humor (Otto&Werner), Geschichte (Störtebeker) und eben Bier boten Anreize genug. Allein die Briefmarkenlandschaft schreckte lange Zeit ab. Doch nun in der dritten Saison bergloser Sommerurlaube war ich auch hierfür bereit jene Reize zu entdecken die ich zuvor nur mit Ödnis verbunden hätte. Und siehe, wir wurden Freunde auf den ersten Blick. Ich mochte die Menschen, ihre saloppe Art, die aber stets von ernst meinender Freundlichkeit bedeckt war, ihren Witz, ihre Mundart – eine Möglichkeit der Sicht das Leben anzunehmen in dieser rauen und kargen Gegend, die sich mit der meinigen problemlos paaren könnte. Und um den provokanten Winkelzug abzuschließen – Ähnliches verspüre ich auch in Bayern. Und dieses gewagte These nehme ich mir einfach heraus als Entdecker dieser vergessenen Ozeane der alten Zutrittsgebiete. Alles natürlich mit anderen Vorzeichen versteht sich, aber die Grundtendenz, hier noch einen Blick auf originäre Lebenstraditionen erhaschen zu können, das denke ich auch hier zu erfahren. Dies erschöpft sich nicht in der vielfältigen Bierkultur der einen oder der eigenständigen Teelandschaft der anderen, wenn man genau hinschaut, genügen schon wenige Tage um die kleinen, feinen Unterschiede in vielen anderen Details zu erkennen. Jene Unterschiede die zunächst der Nationalismus, dann der Faschismus und zuletzt die Globalisierung in jenem großen Klumpen um Berlin herum immer weiter herauswuschen. Kein Grund zum Jammern oder noch dümmeren Reaktionen, doch wenn ich reise, dann steh ich auf derlei Dinge und wie ungleich schöner ist es so etwas im eigenen Kulturraum auszumachen. Divergenz vor der eigenen Haustür hat in meinen Augen deutlich mehr Anziehungskraft als jene, welche ich nur bruchstückenhaft begreife und allenfalls teilweise, gänzlich wohl nie verinnerlichen kann.
Fietslandia – Paralleluniversum auf zwei Rädern
Genug vom Provokant genascht, hin zum offensichtlichen Konsensbericht, so könnte man meinen. Dass Holland hinsichtlich Fahrradfreundlichkeit weit, weit vom Rest der Welt weggegestürmt ist, dürfte allgemein bekannt sein. Und dennoch möchte ich dem noch ein paar Dinge hinzufügen und sei es um dem Umstand in aller Angemessenheit zu huldigen. Von Polen müssen wir diesbezüglich nicht reden, orientieren wir uns mit der Vergleichslatte also lieber an heimischen Gefilden. Manchmal, wenn man einen dieser schicken Fernradwege in Deutschland entlangschnürt, kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass es schon gewaltige Fortschritte zu feiern gibt. Auch wenn man sich am schlechten Beispiel im Osten misst. Doch nach meinem ersten Gazellensprung über die Ems verstand ich wo wir wirklich standen. Ich begriff was möglich ist. Und ich will es auch bei mir zu Hause. Was hier in Deutschland unternommen wird ist nichts anderes als der uninspirierte und visionsarme Versuch dem allgegenwärtigen Autoversum ein paar Fahrradkanäle unterzujubeln. Quasi eine Angliederung und Unterordnung eines in der Hackordnung unterprivilegierten Verkehrsmittels mit dem Ziel den ungestörten Autofluss zu gewährleisten. Dies kann zu großartigen Trassenführungen führen, es kann aber auch zu halbherzigen Bastarden zwischen Straße und Radweg mit irritierender Wegführung und Vorfahrtsbedingungen kommen. In jedem Falle sieht man die Höchstleistungen deutscher Radwegprojekte stets nur bei prestigeträchtigen Fernradwegen in bevölkerungsarmen Regionen. Sobald der Radweg an eine nennenswerte Stadt stößt, weicht er erschrocken zurück vor der wahren Verkehrsmacht, zerfranst und zerfasert sich zunehmend und verkümmert schlussendlich in der schützenden Nähe des Rinnsteins der anderen Entrechteten – dem gemeinen Fußvolk.

In Holland, so begriff ich schon nach kurzer Zeit, geht man grundlegend anders an die Sache heran. Hier besteht nichts Geringeres als ein paralleles Netzwerk von Radwegen zu der bestehenden Autostruktur. Diese sind vorzüglich in Schuss, ausgestattet mit feinstem Leitsystem und mustergültig markiert (auch wenn ich eine Zeit brauchte um zu verstehen, dass man in Holland nicht dem Prinzip der Fernradrouten folgt, sondern das komplette Land mit Kreuzungspunkten ausgestattet hat, so dass man sich mit einer Karte oder einer App flugs die eigene Route zusammenschneidern kann). Dies hat Genuss und Gefahrlosigkeit auf beiden Seiten zur Folge. Man verschränkt und hegt ein wie es für diese beiden Verkehrsmittel sinnvoll ist. Es ist also, der Holländer zeigte es zweifelsohne, nicht zu aufwändig oder unbezahlbar, sondern schlicht und einfach machbar. Ich bin begeistert. Bis ich die Gazelle in die Eisenbahn treiben musste. Es mag verwundern bis regelrecht verstören, aber ein Land mit einer derartigen Ausrichtung auf Zweiradrigkeit stellt sich als Desaster dar wenn es um die Verzahnung von öffentlichem Nahverkehr und Fahrrad geht. Zwei mächtige Stufen gilt es mit dem Rad zu erklimmen um in den Zug zu kommen, die Fahrradabteile sind in Frage des Raums wie der Anzahl ein schlechter Witz – blamabel, äußerst blamabel. Wobei ich das hier für mich so entschlüsselt habe: der Standardholländer scheint an all seinen Lebenseckpunkten Fahrräder zu haben (nur so können sich die unüberschaubaren Herden an Rädern an jedem noch so kleinen Bahnhof erklären) und steigt unbefahrradet in die Bahn. Auch ein cleveres Prinzip, für uns aber leider nicht praktikabel. So holte ich mir dann noch zum Abschluss eine Zerrung beim Fahrradheben in fietslandia! Alles Gute ist halt nie beisammen und: Alles hat Vor- und Nachteile. Sowieso.
In Zahlen:
Tage: 21 (davon aktiv gefahren 17); reine Fahrzeit: 56 Stunden; Gesamtkilometer: 1030 km; längste Etappe: 85 km (19.7.); kürzeste Etappe: 20 km (27.7.); Durchschnittsetappe: ca. 60 km; Durchschnittsgeschwindigkeit: 18,3
Entdecke mehr von Viva Peripheria
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.