Es mag dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass die letzte Bücherkritik dann doch ein wenig zurückliegt. Dies liegt zu gewichtigem Teil an der zurückgelegten Strecke, welche Die Jahre mit Laura Diaz mir abforderten. Ich unterdrücke nach der soeben bewältigten letzten Seite das sich aufdrängende „Puh“ und versuche mich in einer angemessenen Beurteilung des Buchs.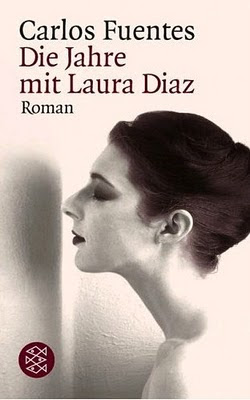 Ich gestehe offen, Bücher die gemeinhin mit dem Stigma, bzw. dem Prädikat „anspruchsvoll“ kokettieren, üben auf mich nicht die allergrößte Anziehungskraft aus. Ich mag Bücher, die mich fesseln und meine Phantasie anregen, bin dabei jedoch abgeschreckt, wenn ich mich kryptischen Metaphernfluten und hemmungslosen Aufzählungsorgien ohne den rettenden Punkt gegenübersehe. Dennoch stehen Bücher dieser Art bisweilen auf meinem Programm. Einerseits weil ich den Zwang verspüre, ihnen pflichtschuldigst den „Muss-man-einfach-gelesen-haben“-Tribut zu zahlen, andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass, so anstrengend diese Bücher sich auch gebärden, durchaus Inspiration und Wissenswertes in ihnen stecken kann.Im Falle des hier besprochenen Buchs entspricht die Sachlage genau der zuvor angedeuteten Problematik. Große Teile der 550 Seiten verlieren sich entweder in besagten Aufzählungsexzessen, die mir immer wieder ein Rätsel sein werden. Ich meine, gibt es im großen, geheimen Handbuch zur Erschaffung von Weltliteratur irgendeine Regel, dass es umso wertvoller wird je vollständiger und detaillierter man aufzählt? Ich kann mir einen mexikanischen Markt durchaus auch vorstellen wenn nicht die nachfolgende Gesamtheit von mir goutiert wird: „Lilien, Gladiolen, Amarante, Stiefmütterchen, Mango, Papaya, Vanille, Mameysapote, Quitten, Tejocote-Mehlbeeren, Ananas, Limetten, Zitronen, Stachelannonen, Orangen, schwarze Sapotes und Breiäpfel.“ Und wenn man dann schon aufzählt, so sollten es auch möglichst spezielle und sonderbare Sachen sein, die nicht jeder kennen dürfte. Wie unterscheidet sich nochmal gleich englischer Lavendel von gewöhnlichem? Neben diesen Schwierigkeiten hat man dann natürlich auch noch die Urgewalten der verklausulierten und doppeldeutigen Sprache zu bewältigen. Ein Autor, dem für die Ausbreitung einer Ideologie keine andere Beschreibung einfällt, als „breitete sich aus wie eine Öllache auf dem Meer, wie gewaltsam in den Penis eingespritzter Eiter aus“, verlangt seinem Leser in der Tat viel ab. Es ist die Natur solcher Literatur, dass ich ihr immer unterstelle, alles im Namen der Kunst komplizierter darzustellen als es nötig wäre. In diesem Sinne fällt in diesem Buch auch ein verräterischer Dialog in dessen Zusammenhang von einer der Hauptfiguren folgendes zu erfahren ist: „Santiago lachte und hätte ihr beinahe vorgeworfen. auf vulgäre Art eindeutig zu sein.“Ich für meinen Teil bin in dieser Hinsicht gerne vulgär, aber dies ist schließlich nur meine Sicht der Dinge. Denn schließlich war nicht alles nur Qual. Ich habe dieses Buch durchaus gern gelesen, da es immer wieder, wenn es die psycho-metaphorischen Torkelpfade verließ, interessante Innenansichten eines 20. Jahrhunderts aus mexikanischer Sicht lieferte. Revolution und Arbeiterbewegung Mexicos, spanischer Bürgerkrieg, Holocaust und McCarthyismus sowie vieles mehr schafften es immer wieder, mich zurück in die Welt und die Familie der Laura Diaz zu holen und mir schlussendlich einen hart erarbeiteten aber lohnenswerten Lesegenuss zu verschaffen. Denn schließlich bin ich ja ein Leser, der fast jede Mühsal zu ertragen bereit ist. Allein für Gedanken wie diesen: „Willst du ein paar Widersprüche, Juan Francisco? Denk an die Bataillone der Yaqui-Indios, die sich Obregón angeschlossen hatten, um den ganz und gar bäuerlichen Pancho Villa in Celaya zu besiegen. Gewöhne dich daran: Revolutionen sind voller Widersprüche, und wenn sie sich dann noch in einem so widersprüchlichen Land wie Mexico abspielen, also dann ist es zum Verrücktwerden.“
Ich gestehe offen, Bücher die gemeinhin mit dem Stigma, bzw. dem Prädikat „anspruchsvoll“ kokettieren, üben auf mich nicht die allergrößte Anziehungskraft aus. Ich mag Bücher, die mich fesseln und meine Phantasie anregen, bin dabei jedoch abgeschreckt, wenn ich mich kryptischen Metaphernfluten und hemmungslosen Aufzählungsorgien ohne den rettenden Punkt gegenübersehe. Dennoch stehen Bücher dieser Art bisweilen auf meinem Programm. Einerseits weil ich den Zwang verspüre, ihnen pflichtschuldigst den „Muss-man-einfach-gelesen-haben“-Tribut zu zahlen, andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass, so anstrengend diese Bücher sich auch gebärden, durchaus Inspiration und Wissenswertes in ihnen stecken kann.Im Falle des hier besprochenen Buchs entspricht die Sachlage genau der zuvor angedeuteten Problematik. Große Teile der 550 Seiten verlieren sich entweder in besagten Aufzählungsexzessen, die mir immer wieder ein Rätsel sein werden. Ich meine, gibt es im großen, geheimen Handbuch zur Erschaffung von Weltliteratur irgendeine Regel, dass es umso wertvoller wird je vollständiger und detaillierter man aufzählt? Ich kann mir einen mexikanischen Markt durchaus auch vorstellen wenn nicht die nachfolgende Gesamtheit von mir goutiert wird: „Lilien, Gladiolen, Amarante, Stiefmütterchen, Mango, Papaya, Vanille, Mameysapote, Quitten, Tejocote-Mehlbeeren, Ananas, Limetten, Zitronen, Stachelannonen, Orangen, schwarze Sapotes und Breiäpfel.“ Und wenn man dann schon aufzählt, so sollten es auch möglichst spezielle und sonderbare Sachen sein, die nicht jeder kennen dürfte. Wie unterscheidet sich nochmal gleich englischer Lavendel von gewöhnlichem? Neben diesen Schwierigkeiten hat man dann natürlich auch noch die Urgewalten der verklausulierten und doppeldeutigen Sprache zu bewältigen. Ein Autor, dem für die Ausbreitung einer Ideologie keine andere Beschreibung einfällt, als „breitete sich aus wie eine Öllache auf dem Meer, wie gewaltsam in den Penis eingespritzter Eiter aus“, verlangt seinem Leser in der Tat viel ab. Es ist die Natur solcher Literatur, dass ich ihr immer unterstelle, alles im Namen der Kunst komplizierter darzustellen als es nötig wäre. In diesem Sinne fällt in diesem Buch auch ein verräterischer Dialog in dessen Zusammenhang von einer der Hauptfiguren folgendes zu erfahren ist: „Santiago lachte und hätte ihr beinahe vorgeworfen. auf vulgäre Art eindeutig zu sein.“Ich für meinen Teil bin in dieser Hinsicht gerne vulgär, aber dies ist schließlich nur meine Sicht der Dinge. Denn schließlich war nicht alles nur Qual. Ich habe dieses Buch durchaus gern gelesen, da es immer wieder, wenn es die psycho-metaphorischen Torkelpfade verließ, interessante Innenansichten eines 20. Jahrhunderts aus mexikanischer Sicht lieferte. Revolution und Arbeiterbewegung Mexicos, spanischer Bürgerkrieg, Holocaust und McCarthyismus sowie vieles mehr schafften es immer wieder, mich zurück in die Welt und die Familie der Laura Diaz zu holen und mir schlussendlich einen hart erarbeiteten aber lohnenswerten Lesegenuss zu verschaffen. Denn schließlich bin ich ja ein Leser, der fast jede Mühsal zu ertragen bereit ist. Allein für Gedanken wie diesen: „Willst du ein paar Widersprüche, Juan Francisco? Denk an die Bataillone der Yaqui-Indios, die sich Obregón angeschlossen hatten, um den ganz und gar bäuerlichen Pancho Villa in Celaya zu besiegen. Gewöhne dich daran: Revolutionen sind voller Widersprüche, und wenn sie sich dann noch in einem so widersprüchlichen Land wie Mexico abspielen, also dann ist es zum Verrücktwerden.“
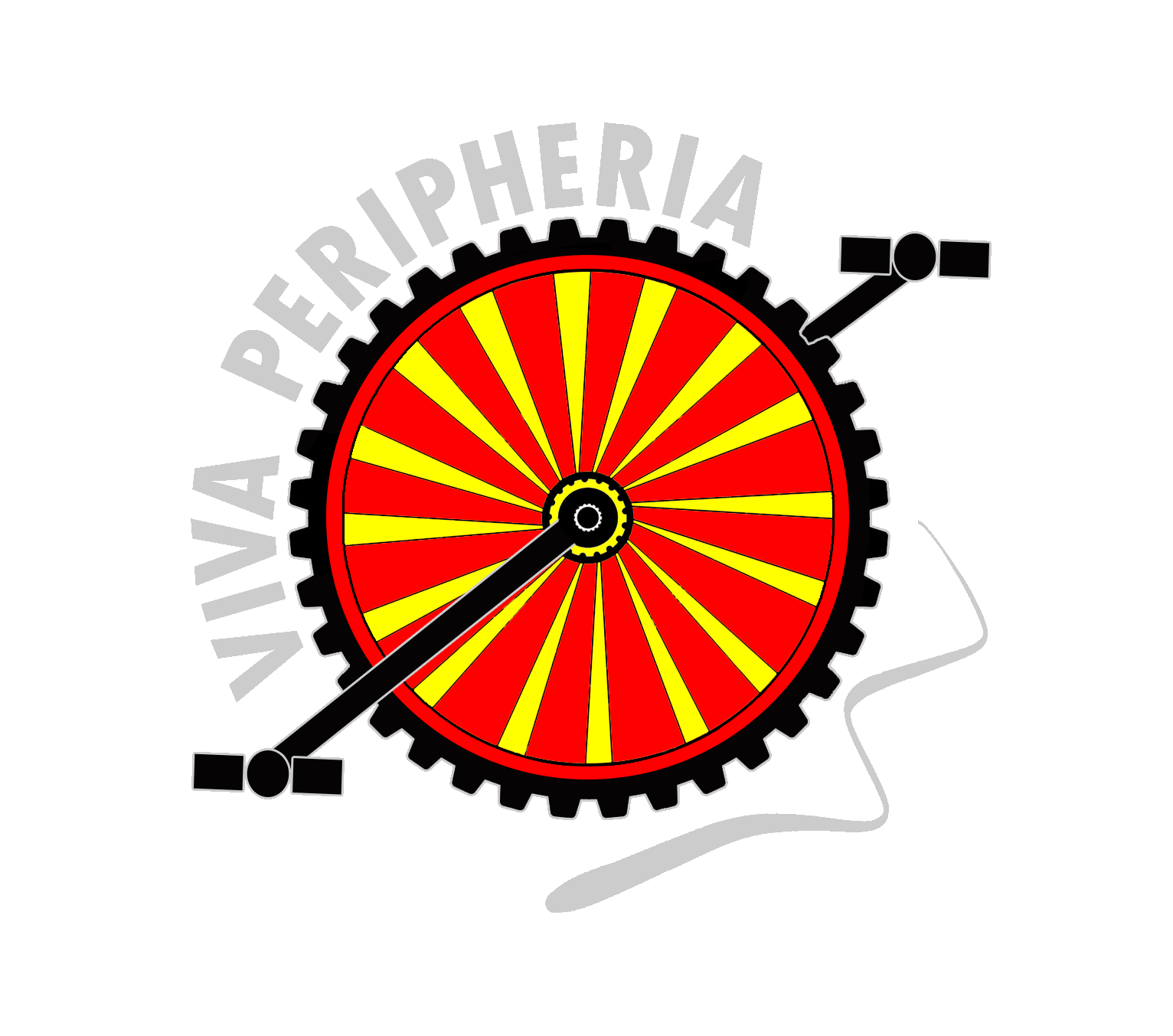

Pingback: Frisch gelesene Bücher: Die Rebellen von Irland – Viva Peripheria