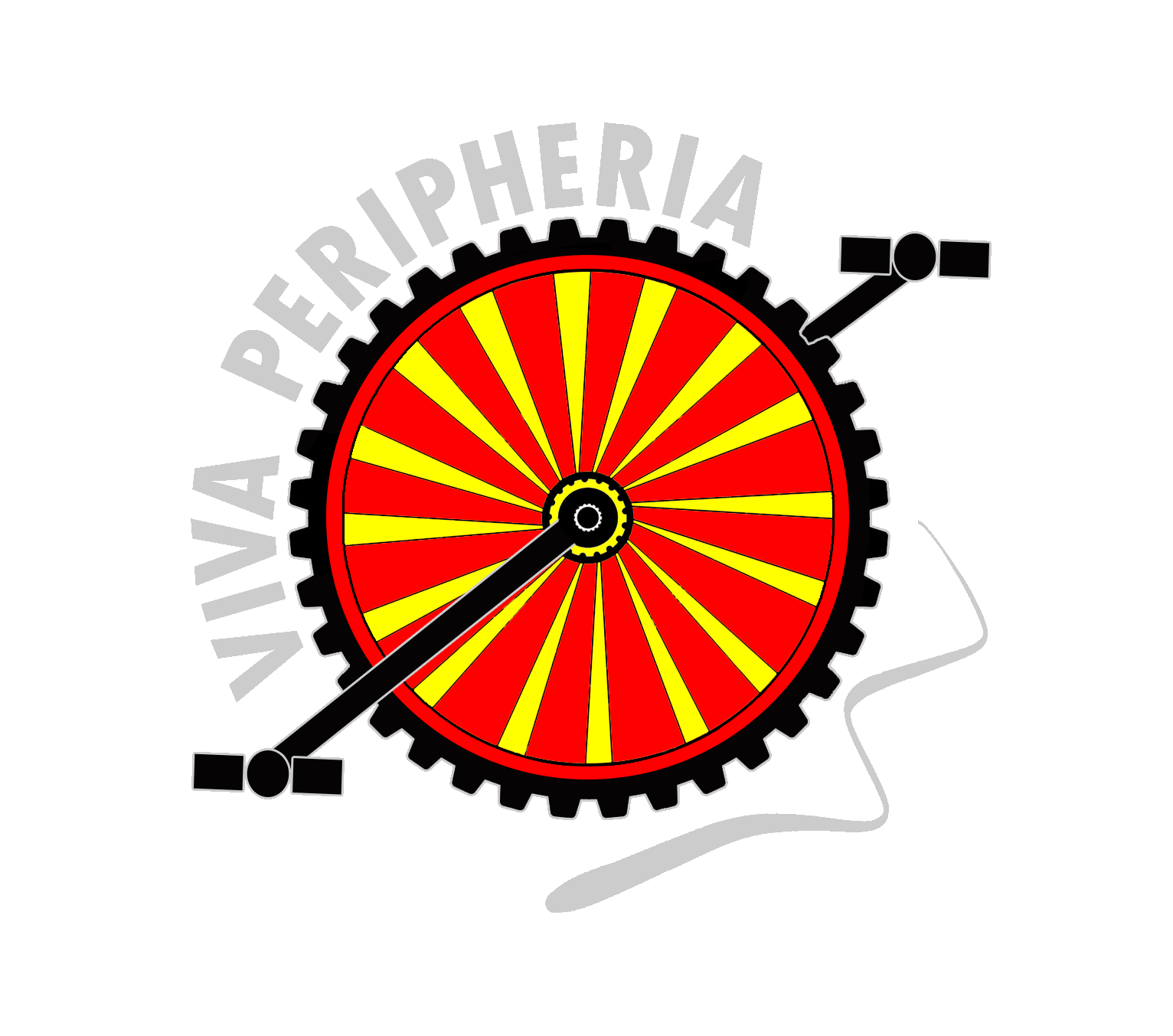Zu Beginn des Jahres stand das Bücherjahr noch ganz im Zeichen des Projekts „Pro-Land-ein-Buch“. Wobei, genaugenommen eigentlich auch wieder nicht, denn die Zeiten der Kleinstaaterei und dem hieraus resultierenden Büchergalopp waren längst vorbei. Über ein halbes Jahr verbrachten wir in der griechisch-türkischen Hemisphäre und da ich zu Zypern nichts fand, „musste“ ich in dieser langen Zeit prinzipiell nur zwei Bücher lesen. Hier fiel meine Wahl auf das genauso spannende wie mitreißende „Athen, Paradiesstraße“ sowie das düstere „Schnee“, zu dem ich nichts ahnend griff, nur um mich kurzerhand selbst am Ort der Handlung zu befinden. Und das sogar mit Schnee!
Nachdem ich von der länderspezifischen Mission befreit war, konnte ich endlich wieder lesen was ich wollte. Merkwürdigerweise blieb meine Buchauswahl zum Teil nah an der für mich aktuell erlebten Umgebung. So versuchte ich zumindest ein wenig Klarheit zu erlangen in dem ich Bücher wie die „Geschichte der Türkei“ und „Die Kurden. Geschichte, Politik, Kultur“ verschlang. Viel erbrachten beide Bücher nicht, zumindest waren sie weder pointiert, noch erhellend oder in irgendeiner anderen Weise inspirierend als das ich sie bedingungslos empfehlen würde.
Neben den Räumen, die wir durchquerten, über die ich mehr erfahren wollte und welche sich daher in meinen Lektüren niederschlug, gab es natürlich noch ein anderes Ereignis was der durchschnittliche Erdenbürger mit dem vergangenen Jahr verbinden würde – die Seuche. Langsam aber unbeirrt gelang es diesen winzigen Erregern unsere Reise deutlich zu entschleunigen. Was lag da näher als sich mit der Thematik mal etwas näher zu beschäftigen. Diesem ganz speziellen apokalyptischen Reiter hatte stets am wenigsten Aufmerksamkeit gewidmet. Nachdem ich mich nun in kürzester Zeit durch ganze drei Bücher fraß, sollte diese Benachteiligung dann wohl endgültig der Vergangenheit angehören. Empfehlen kann ich keines davon so richtig. Dabei hatte ich mir von Karin Möllings „Viren: Supermacht des Lebens“ viel versprochen. Eine der ausgewiesenen Expertinnen zum Thema Viren tritt an um das negative Image von Viren etwas zu korrigieren – das klang interessant und wie ein idealer Einstieg in eine Welt die mir weitestgehend fremd war. Leider steht das Buch in meinen Augen als Paradebeispiel dafür wie Wissenschaftskommunikation nicht laufen sollte. Dröge, endlose Ausführungen, welche Sprache nicht als Stilmittel sondern bestenfalls als Kommunikationsaggregat verwendete und jede Menge selbstreferentielle und wettbewerbsverliebte Darstellungen nach dem Schema „Wer-hats-erfunden“, die keinen interessieren, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wenn man einfach nur auf verständliche Weise etwas erklärt bekommen möchte. Auch von „1918. Die Welt im Fieber“ hatte ich mir deutlich mehr versprochen. Als historisch interessierter Mensch hätte ich wahrscheinlich auch so mal zu diesem Buch gegriffen, da die Spanische Grippe für mich immer ein reichlich unterbelichtetes Thema war. Die Autorin unterstützt diese Neugier anfangs auch und schafft es auch, das Thema als ein globales Problem recht dicht darzustellen. Dennoch fehlte mir ein wenig Struktur und der Mut zu Rückschlüssen und Deutungen im Schlussteil, welcher es zu einer Empfehlung gemacht hätte. Das vielleicht noch empfehlenswerteste Bändlein zum Thema wäre war „Seuchen“ von Kai Kupferschmidt. Prägnant und verständlich wird hier auf dem bekannten 100-Seiten-Format von reclam ein Einstieg in die Materie geboten wie ich ihn gesucht hatte. Außerdem erinnere ich noch heute an die Wirkung der letzten Worte dieses Buches. Mahnende Worte, die meines Erachtens nicht nur auf Seuchen anwendbar sind.
„Neue Seuchen werden kommen. Ob sie zur Katastrophe werden, wird vor allem davon abhängen, was am Ende überwiegt: Empathie und Erfindungsreichtum oder Ignoranz und Egoismus.“
Zwei Bücher, die mich 2020 beeindruckten, sollen noch gesondert erwähnt werden. Einerseits „Corpus Delicti„, ein schon vor über einem Jahrzehnt erschienener Roman von Juli Zeh, der auf etwas mehr als 200 Seiten ohne viel Firlefanz das Szenario einer zukünftigen Gesundheitsdiktatur beschreibt. Eine weitere Dystopie also, mag der von deiem Genre überflutete Zeitgenosse gelangweilt maulen. Und dann auch noch zu dem Thema… Aber tatsächlich elektrisierte mich die Schilderung überraschenderweise und ich resümierte nach Ende der Lektüre in herausfordernder Pose, dass so ein Buch an unseren Schulen gelesen werden sollte. Nur um kurz darauf zu erfahren, dass dem so sei, woraufhin ich mich friedlich und „wollte-ja-nur-gesagt-habend“-murmelnd trollte.
Anderseits sei mit großer Verehrung auf den Reisebericht namens „Sowjetistan“ von Erika Fatland verwiesen. Es birgt ein gewisses Restrisiko zum Ende einer langen Reise ein Buch über lange Reisen zu lesen. Dennoch taten wir es. Wir erfuhren viel Verlockendes, Aufregendes und Absurdes über die fünf Stans, von denen sich mindestens drei auf dem ursprünglich angedachten Menüplan unserer eigenen Reise befunden hatten und zu denen es uns nun mehr denn je hinzieht. Doch die unbefangenen und fröhlichen Beschreibungen der norwegischen Autorin vermochten es, uns weniger mit Wehmut ob verpasster Gelegenheiten denn mit Vorfreude auf kommende Abenteuer anzustecken.

Wie man an dem obigen Bild unschwer erkennen kann, gab es nicht für alle Bücher bei goodreads ein Titelbild, doch nicht bei jedem lohnt ein Nachtrag desselbigen und ich hülle fast dankbar den Schleier des Unerkannten über diese Bücher. Hier nun eine schlichte Liste der Bücher, die ich wirklich empfehlen kann und möchte. Sechs von 30 – nicht gerade eine überzeugende Ausbeute, andererseits es gibt üblere Rückblicke als jene, in denen man alle zwei Monate ein richtig gutes Buch lesen durfte.
- „Sowjetistan„, Erika Fatland
- „Corpus Delicti„, Juli Zeh
- „Qualityland„, Marc-Uwe Kling
- „Lovecraft Country„, Matt Ruff
- „Die Jakobsbücher„, Olga Tokarczuk
- „Die Weltgeschichte der Pflanzen„, Wolfgang Seidel
Entdecke mehr von Viva Peripheria
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.