- Wie es begann oder was vor einer Weltreise alles getan werden muss
- Warum es begann oder wie wir vom Hamsterrad aufs Fahrrad sprangen
- Und es beginnt.
- Von Spreeathen nach Elbflorenz
- Mehr Wasser wagen
- Die „Elbe“ hinauf zur Moldau
- Bonustrack 01 – Die Elbe
- Tanze Lumbago mit mir
- Die unerträgliche Leichtigkeit der Moldau
- Tschechien: Was noch zu sagen bleibt
- Der erste 1000er
- Bonustrack 02 – Die Moldau
- Servus Donau
- Der erste Monat
- Österreich: Was noch zu sagen bleibt
- Die Vierstaatentournee
- Kilometer 2000
- Bonustrack 03 – Die Donau
- Von der Sava nach Sarajevo
- Zwei Monate unterwegs
- Bonustrack 04 – Von Wien nach Bosnien
- Von Sarajevo an die Adria
- Russen, die auf Ziegen starren
- Drei Monate
- Ratgeber: Peaks of the Balkans
- 3000 Kilometer
- Bosnien-Herzegowina: Was noch zu sagen bleibt
- Bonustrack 05: Bosnien – Klappe, die Erste
- Montenegro: Was noch zu sagen bleibt
- Vier Monate
- Durch das Land der Skipetaren
- 4000 Kilometer
- Bonustrack 06 – Giro di Salento
- Fünf Monate
- Bonustrack 07 – Von Sarajevo an die Adria
- Albanien: Was noch zu sagen bleibt
- Der Rest des Balkans – von Albanien nach Peloponnes
- 5000 Kilometer
- Die Outdoor-Küche: Ein kulinarischer Streifgang
- Sechs Monate
- Alle Räder stehen still: Winterpause
- Diskret auf Kreta
- Stayin‘ Olive – eine Liebeserklärung
- Sieben Monate
- Bonustrack 08 – Von zweien, die auszogen, das Melken zu lernen
- 6000 Kilometer
- Acht Monate
- Bonustrack 09 – Gefahren in Albanien
- Ohne Fleisch keine Reis‘
- Griechenland: Was noch zu sagen bleibt
- Neun Monate
- 7000 Kilometer
- Bonustrack 10 – Reif für die Inseln
- Zypern: Was noch zu sagen bleibt
- Zehn Monate
- 8000 Kilometer
- Radfahren in Zeiten der Seuchenapokalypse – Teil 1
- 9000 Kilometer
- Ein Jahr
- 10000 Kilometer
- 13 Monate
- Bonustrack 12 – Cyprus Hill
- 11111 Kilometer
- Bulgarien: Was noch zu sagen bleibt
- Dankeschön
- Türkei: Was noch zu sagen bleibt
- 14 Monate
- Serbien: Was noch zu sagen bleibt
- Ausrüstungskritik – ein Hui und Pfui des Zubehörs
- Rumänien: Was noch zu sagen bleibt
- Ungarn: Was noch zu sagen bleibt
- Polen: Was noch zu sagen bleibt
- Radfahren in Zeiten der Seuchenapokalypse – Teil 2
- Bonustrack 13 – Immer weiter, ganz nach Kars
- Bonustrack 14 – Türkei 2020, die Rückkehr
Wenn die Straßen sich lichten und die Städte sich leeren, wenn im munteren Sonnenschein selbst die einladendsten Picknickplätze am Meer mit Absperrband versehen sind und die Menschen am Wegesrand sich furchtsam hinter ihren Schutzmasken verstecken, dann wird selbst die abenteuerlichste Radreise zweifellos auf ein neues Level gehoben. Wir hatten uns, wie im letzten Rapport bereits ausgeführt, nach reiflicher Überlegung gegen einen Spielabbruch entschieden und wollten vielmehr, die Städte weitgehend meidend unsere Fahrt durch die Natur fortsetzen. Ganz so wie wir es die Monate zuvor auch schon ohne Seuche praktiziert hatten. Die lange Distanz vom östlichen Ende der Türkei bis zu ihrem europäischen Wurmfortsatz erschien uns, gemächlich gefahren, als ausreichend lange Strecke um den Ausnahmezustand auszusitzen und dann eventuell auch irgendwie aus unserer geliebten Türkei ausreisen zu können. So weit so vage unsere Pläne. Ziemlich schnell, nachdem wir diese wackeligen Ideen für die nächsten Wochen ausgebrütet hatten, schlug die Wirklichkeit humorlos dazwischen und klärte die Angelegenheit trocken und kompromisslos. Alle Grenzen waren dicht, kein Bus, kein Zug, kein Flug – auf einmal war unser absurder Plan der scheinbar einzig gangbare. Angesichts dieser erfrischenden Alternativlosigkeit, traten wir noch ein wenig beherzter in die Pedalen und genossen jeden Tag, der uns unter freien Himmel vergönnt war umso mehr. Die bizarren Eindrücke dieser letzten Wochen möchte ich hier nun versuchen kurz anzureißen.

Sehr viel ist bei solch einer radikalen Veränderung der Umgebung natürlich auch reine Kopfsache. Eine unserer größten Sorgen war und ist, dass sich die Angst vor der Seuche in irrationale Fremdenfeindlichkeit verwandeln könnte und die vor kurzem noch so unfassbar gastfreundlichen Türken mit Fackeln und Mistgabeln vor unserem Zelt stehen würden. Es ist halt nicht nur das mulmige Gefühl, welches einen nun auf einmal angesichts einer ausgestorben wirkenden Häuserzeile beschleicht, welches man früher einfach nur als entspannend wahrgenommen hätte. Plötzlich interpretiert man skeptische Blicke als scheeles Abschätzen, Höflichkeit als Abneigung und Interesse an dem Woher und Wohin als vorurteilsbeladenes Aushorchen. „In der Krise zeigt sich der Charakter“ soll einstmals ein gewisser Kanzler geäußert haben. „Wer auch in unangenehmen Situationen in fremden Ländern das Unbestimmte genießen kann, ist kein Tourist mehr sondern ein Reisender“, sage ich.

Unser erster Ausreißversuch führte uns am 24. März nach Erzurum. Noch einmal kamen wir in den kostbaren Genuss einer Eisenbahnfahrt durch die verschneiten Berge Ostanatoliens. Von Erzurum nahmen wir die schnurgerade Straße gen Norden und waren bald in den menschenleeren, lebensfeindlichen Gebirgsregionen nach denen wir uns in der schmutzigen Stadt verzehrt hatten. Begeistert von dieser grenzenlosen Freiheit registrierten wir wohlwollend den neuen Höhenrekord unserer Reise – 2090m. Nach diesem Höhepunkt begann eine tagelange Abfahrt hinab zum Schwarzen Meer. Diese Reise durch Klima- und Vegetationszonen gleicht auch einer Spazierfahrt durch die Erdgeschichte, die uns vollends begeisterte und definitiv zu den spektakulärsten Routen dieser Radreise gehörte. Auch seuchentechnisch erfüllte diese Strecke all unsere Erwartungen: bis Artwin, dem administrativen Zentrum der Region, durchfuhren wir lediglich verschüchterte Bergdörfer und Menschen sahen wir allenfalls in ihrer karosseriegewandeten Version. Dieses glückliche Zustand hielt an bis wir den bislang längsten Tunnel dieser Reise durchquerten (5228m), denn an dessen Ende trafen wir auf bitterkalte Temperaturen und fanden uns wieder im stockdusteren und wenig einladend wirkenden Hopa am Schwarzen Meer.

Hopa empfing uns nicht nur mit Kälte, Regen und einer eisern geschlossenen Grenze zum, quasi in Spuckweite befindlichen Georgien. Nein, hier realisierten wir auch, dass sich während unserer mehrtägigen Zivilisationsabsenz einiges zum Argen entwickelt hatte. Geschäfte und Hotels waren größtenteils geschlossen, die sonst hochfrequentierte Fernverkehrsstraße war nur noch eine frequentierte Straße. Auch die Menschen kannten offensichtlich nur noch ein Thema, wenngleich sie es noch mit viel Humor und Gelassenheit aufnahmen. Und so standen wir nun bibbernd in einer alles andere als einen gemütlichen Eindruck erweckenden Grenzstadt. Die üblichen Methoden, sich schnell ein Bett für die Nacht zu organisieren, waren weggebrochen. Was macht der nicht aus der Ruhe zu bringende Reisende? Abwarten und Bier trinken. Schnell fand sich bei diesem Zeitvertreib Kontakt zu den, nach wie vor freundlichen Einheimischen und schwups saßen wir in einem warmen Hotelzimmer und konnten es mal wieder nicht fassen. Es sind exakt diese überraschenden, alles umstülpenden Momente für die ich das Reisen so sehr liebe!

Wir verbrachten geschlagene vier Nächte in unserem sicheren Asyl im Otel Ankara. Erst am 31. März hatten sich die düsteren Wolken verzogen, so beluden wir unsere Räder und nach einigen sehnsuchtsvollen Blicken gen Osten, kehrten wir dem Kaukasus endgültig den Rücken und nahmen Kurs auf Europa. Nach solch einer langen Zwangspause fühlten wir uns zurück auf der Straße pudelwohl. Obwohl die Hauptverkehrsroute an der Schwarzmeerküste wohl spürbar leerer als sonst war, wurden wir doch bisweilen heftig von den Trucks an die Leitplanke geweht und fragten uns mit Grausen, wie es hier wohl zu „normalen“ Zeiten zugehen musste. Bereits an diesem ersten Tag auf der Schwarzmeerroute erlebten wir das veränderte Gewand, der von uns in den Monaten zuvor so oft genossenen türkischen Gastfreundschaft. Trotz all der Unbilden wollte es sich Murat nicht nehmen lassen, uns etwas Gutes zu tun und es war herzzerreissend mitanzusehen, wie er trotz aller Angst, Unsicherheit und Bedenken unter Aufbietung aller gegebenen Schutzmaßnahmen uns willkommen hieß. Und so tranken und speisten wir mit Maske und Handschuhen, stets auf Abstand bedacht in seinem Strandhaus, blickten aufs Meer und genossen einmal mehr die Absurdität des Moments in vollen Zügen.
Nach diesem tollen Moment, der uns viel Kraft und Hoffnung schenkte, radelten wir unverdrossen weiter und machten recht bald danach Bekanntschaft mit den Vertrauen einflößenden Straßensperren im Land. Wir hatten bereits in den Bergen hiermit erste Erfahrungen gesammelt. Wie hierzulande nicht anders gewohnt, beherrschte keiner der zahlreichen Uniformierten und Bekittelten ein Wörtchen in einer anderen Sprache als jener, die allgemein als die Mutter aller Sprachen angesehen wird – und zwar Türkisch (siehe: „Sonnensprachtheorie“). Mit Händen, Füßen und google translator einigte wir uns nach ausgiebigen Fiebermessen, emsiger Passkontrolle und jeder Menge elegant geschwungener Zeigefinger darauf, dass es sich bei uns um Irre, aber zumindest nichtinfizierte Irre handle und es das beste wäre, wenn unsere Anwesenheit ihre Autorität nicht weiter unnötig strapazierte. Wir erhielten ein wunderschönes, handgeschriebenen Dokument, welches uns die Heimreise auf der Schwarzmeerroute gestattete. Selbstverständlich aber nur wenn wir unterwegs nichts anfassen und nicht in Städten anhalten, geschweige denn dort nächtigen würden.

Fortan gehörte die tägliche Fieberkontrolle an der Straße zu unserem bizarren Alltag. Ansonsten gab es kaum Fragen zum Woher, Wohin oder gar Warum. Vielmehr vermittelten all die nervösen Gesetzeshüter den Eindruck, dass sie uns am liebsten schnell los werden wollten und so taten wir ihnen den Gefallen. Recht bald verstanden wir auch das, den Kontrollen innewohnende System. Der Verkehr zwischen den einzelnen Verwaltungsbezirken sollte kontrolliert werden und wenn man diese Grenze passieren wollte, benötigte man eine Genehmigung. Wir standen jedoch über dem Gesetz, denn wir waren ja, wie gesagt, auf der Heimreise. Und so überquerten wir, immer wieder mit dem bangen Gefühl jetzt bloß keinen Hauch von erhöhter Temperatur zu haben, eine Grenze nach der anderen.

Eine weitere Angelegenheit, die sich unter den veränderten Umständen etwas difizil gestaltete, war die der Übernachtung. Einerseits, so sollte man denken, befanden wir uns ja im Paradies. Sämtliche touristischen Einrichtungen am Strand waren verlassen und lockten mit idyllischen Wiesen nebst Sanitäranlagen und allem was Wildzelters Herz begehrte. Doch die Schließung derselben war vom Staat angeordnet und wurde auch demzufolge auch überwacht. Daher stellte unsere Frage, ob wir hier für eine Nacht bleiben könnten, die meisten Inhaber von Strandbars, Campingplätzen o.ä. vor arge Bedrängnis. So galt es entweder komplett verlassene Anlagen zu finden und dort mit der einsetzenden Dämmerung vollendete Zeltsachen zu schaffen oder risikobereite Menschen zu finden, die ein schwer einsehbares Plätzchen auf ihren Grundstücken bereitzustellen wussten. Natürlich kann aber auch das klandestinste Schlafplatzmanöver enttarnt werden. Und was dann folgte, ähnelte gewissermaßen dem Straßensperren-Check nur ohne Fiebermessen, dafür aber mit viel mehr Uniformierten und noch viel, viel mehr Planlosigkeit. Was sich hier offenbarte glich einer munteren Aufführung eines klassischen Dramas aus dem Genre des autokratischen Verantwortungspingpongs. Etliche Herren palaverten gewichtig in unsere Richtung, zu Allah, in ihr Handy und zu ihren emsig herumschwirrenden Untergebenen. Eben jene wiederum pendelten unablässig mit Sorgesmiene und gramgebückten Schultern zwischen den Delinquenten, also uns, und ihren Gebietern. Sie waren für diese Aufgabe vorgesehen, da sie einerseits eher fremdsprachengewandt waren und andererseits, so schien es, war es den jeweiligen Würdenträgern ein Graus, sich direkt und ohne Filter mit dem ungeliebten Problem zu befassen. Dieses unübersichtliche Kommunikationsgemuddel ergänzte sich dann zumeist noch ganz erklecklich mit einem hyperventilierenden Kompetenzgerangel zwischen den diversen, anwesenden Institutionen. Wir saßen dann meistens wie mäßig amüsierte Theaterbesucher, welche die Pointe des Stücks nicht ganz begriffen, am Rande des Geschehens, wiederholten die immer gleichen Antworten und setzten nach viel Lärm um Nichts unsere Reise unbeschadet fort.

Nach gut drei Wochen dieser Art von „Radeln im Untergrund“ erreichten wir am 9. April Ünye, ein kleines, nett anzuschauendes Städtchen kurz hinter Ordu. Wir entschlossen uns, es hier einfach dreist mit einem Hotel zu versuchen und, schau an, schon der erste Versuch gelang. Ohne viel Wimperngezucke wurden wir im „Otel Güney“ willkommen geheißen und ergötzten uns alsbald an den lang entbehrten Freuden wie einer heißen Dusche, einem beheizten Zimmer und solide schnurrenden WLAN. So sehr wir diesen unerwarteten Luxus genossen, ahnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er uns länger als geplant beschieden sein sollte. Denn in der Nacht zum Wochenende rief die türkische Staatsführung zur Überraschung der überwiegenden Mehrheit aller Untertanen einen kompletten lockdown aus. Wir saßen also hier fest. Und wir hätten es kaum besser treffen können. Auf der sonnigen Terrasse erhielten wir umstandslos drei warme Mahlzeiten und in dem weitestgehend leeren Hotel hatten wir reichlich Ruhe um in erquickenden Mußestunden vieles zu tun, für was an einem durchschnittlichen Radtag meistens die Zeit fehlt.

Bleibt nun nur die Frage, wie geht’s weiter? Dürfen wir nach diesem Wochenende wieder raus auf die Landstraße oder endet unsere Freiheit bis auf weiteres hier? Und wenn, wo kommen wir nächstes Wochenende unter? Wie kommen wir nach Europa wenn Istanbul kippt und weiterhin kein Transportmittel sich für uns bewegt? Fragen über Fragen… Es war immer spannend in den letzten Monaten, aber dieser Spannungsbogen ist ein ganz ein besonderer!
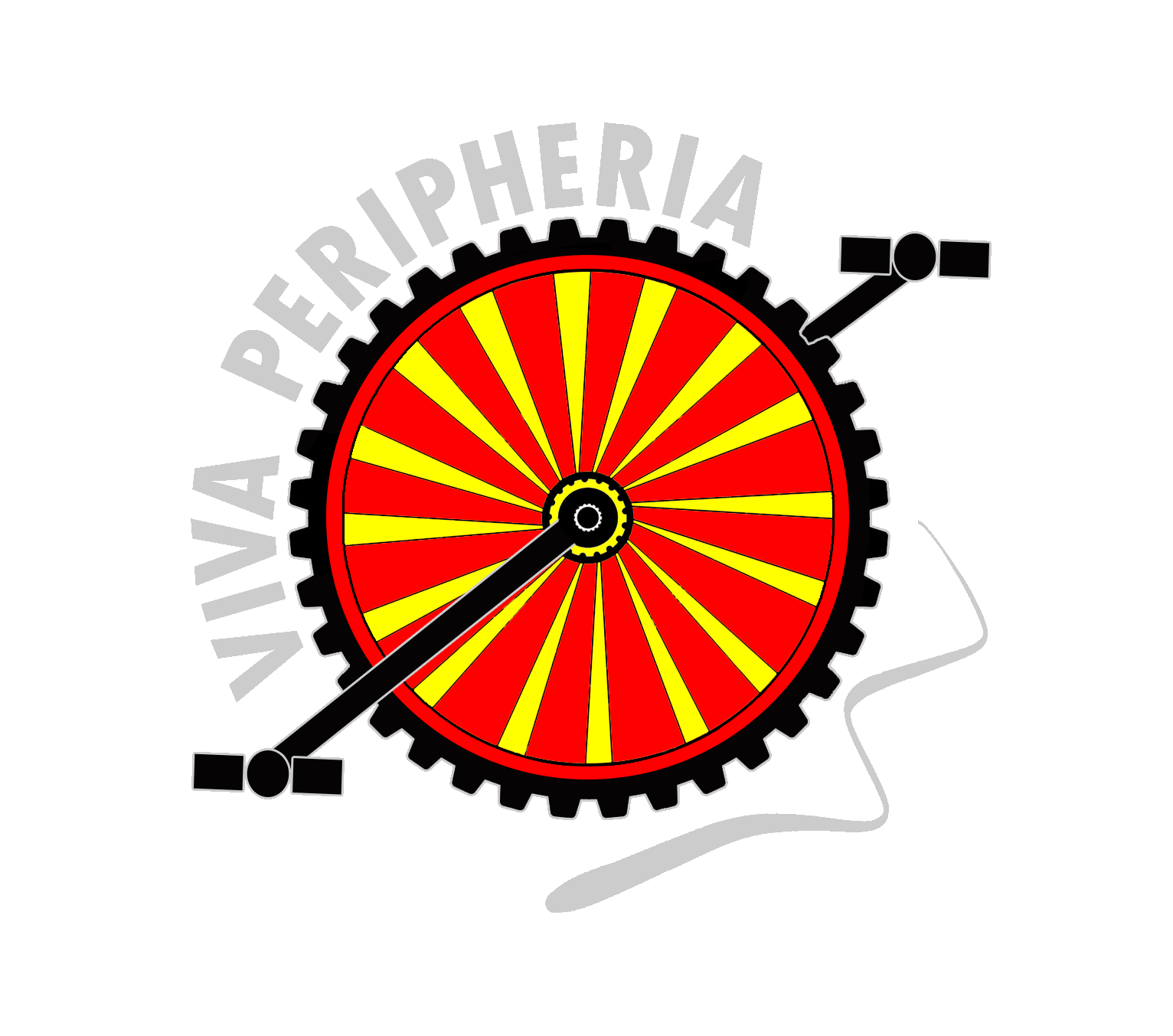


Bei manchen Eurer bisherigen Episoden habe ich mir gedacht, „Oh, da wäre ich gerne dabei“, meist wenn die Fotos und der Text so verführerisch sind, dass ich die zugrundeliegende Bein- und Sitzarbeit kurz vergesse.
Aber bei der Fahrt von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt hätte ich wahrscheinlich mal die Geduld verloren.
Andererseits habt Ihr nun mehr Platz auf dem Highway.
Ich war zuletzt vom 11. bis zum 17. März auf einer der Azoreninseln unterwegs. Ich reiste per Anhalter, und es wurde von Tag zu Tag schwieriger, jemandem zum Anhalten zu bewegen, auch weil ich offensichtlich nicht azoreanisch aussehe.
Gegen Ende hin wurde es dann manchmal schon fast unangenehm, weil es zu spüren war, dass ich nur mehr als potentieller Virenträger angesehen wurde.
In diesem Artikel beschreibe ich die Woche und die täglichen Veränderungen:
https://andreas-moser.blog/2020/04/05/pico/
Am Ende bin ich dann auf den Azoren geblieben, aber fest an einem Ort. Da denke ich wie Ihr: „Es könnte schlimmer sein.“ Es wird, in Gottes Namen, ja nicht geradezu sieben Jahre dauern.
“ so wir beluden unsere Räder…“ Ich sage ja immer meinen „Schülern“: Im deutschen Hauptsatz steht das konjugierte Verb an zweiter Stelle. ;-)
Sofort alles wieder korrekt zurechtgerückt.
Pingback: Radfahren in Zeiten der Seuchenapokalypse – Teil 2 – Viva Peripheria
Pingback: Türkei: Was noch zu sagen bleibt – Viva Peripheria
Pingback: Bonustrack 14 – Türkei 2020, die Rückkehr – Viva Peripheria