- Warum es wieder losgeht oder eine neuerliche Hamsterradkritik
- Von Friedrichshain über Friedrichshain hin zu böhmischen Dörfern
- Von tschechoslowakischen Höhen und Tiefen
- Diashow, die erste: Von Heidesee bis fast zum Triglav
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (1) von Altungarisch bis Walachei
- Über idyllische Plattitüden und endloses Grün
- Über das januszipfelige Istrien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (2) von Adige bis Theodor Mommsen
- Reisen nach Zahlen – 100 Tage
- Von einer die auszog das Fürchten zu verlernen
- Der italienischen Reise erster Teil
- Die besten Gerichte von draussen
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (3) von Basilikata bis Wildschwein
- Der italienischen Reise zweiter Teil
- Der italienische Reise dritter Teil
- Einblicke ins Reisetagebuch
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (4) – Von Ätna bis Zitrusfrüchte
- Reisen nach Zahlen – Tag 200
- Währenddessen in Afrika
- Così fan i tunisini
- Eisenbahnfahren in Tunesien
- Von Menschenhaufen und anderen Platzhengsten
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (5) von Agave bis Tuareg
- Tunesien – auf der Suche nach der Pointe
- Reisen nach Zahlen – Tag 300
- Sardinien – der italienischen Reise letzter Teil?
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (6) von Asinara bis Tafone
- Kleine, feine Unterschiede
- Im Autokorsika über die Insel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (7) von Elba bis Tarasque
- Fahrradfahren (u.v.m.) wie Gott in Frankreich – erste Eindrücke
- Jahrein, jahraus, jahrum
- Ausrüstung für Langzeitreisende – ein paar grundlegende Gedanken
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (8) von Baselstab bis Wasserscheidenkanal
- Reisen nach Zahlen – Tag 400
- Querfeldein und mittendurch – Frankreich vom Rhein bis zum Atlantik
- Wissensstrandkörner aus dem Reisewatt – Gezeiten-Sonderausgabe
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 (Frankreich)
- Projekt-Radria-Gleiche (Tag 426)
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (9) von El Cid bis Wanderdüne
- Der Jakobsweg – ein fader Pfad im Kurzporträt
- Ratgeber: Fahrradfahren auf dem Eurovelo 1 (Velodyssée)
- Unter Jakoblingen – von den Pyrenäen bis ans Ende der Welt
- Wissensplitter aus dem Reisesteinbruch (10) von Don Sueros de Quiñones bis Saudade
- Reisen nach Zahlen – 500 Tage
- Kopfüber durch Portugal und zurück
- Aus dem Reiseplanungslabor: Arbeitskreis Westafrika
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (11) von Azulejos bis Wasserballastbahn
- Meerdeutigkeit
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (12) Von Al-Andalus bis zu den Säulen des Herakles
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (13) von Alcazaba bis zur Unbefleckten Empfängnis
- Andalusien – ein Wintermärchen
- Reisen nach Zahlen – 600 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (14) von Flysch bis Trocadéro
- Rowerem przez peryferie
- Von Aisha Qandisha bis Moulay Idriss (15) Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch
- Jauchzend betrübt – die Packungsbeilage für Marokko
- Marokkohochjauchzende Menüvorschläge
- Reisen nach Zahlen – 700 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (16) von Corniche bis zur Via Domitia
- Die „Reiß-dich-am-Riemen“-Tour oder Radwandern für Durchgeknallte
- Ratgeber: Radfahren auf dem Eurovelo 8 – „La Méditerranée“
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (17) von Bektaschi bis Vučedol
- Giro della Jugoslavia
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 – das Balkankapitel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (18) von Chinesischer Jujube bis Ъъ
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch – MYTHOLOGIESPEZIAL – eine kleine Umschau des Irrsinns
- Was wurde eigentlich aus dem Römischen Reich? Eine ausführliche Inventur der verbliebenen Provinzen
- 852 Tage – Doppelt hält besser
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (19) von Atatürk bis Tigris
- Von Bačka Palanka zum Goldenen Vlies – Endspurt zum Kaukasus
- Z Nysy do Nysy
- Jahresrückblick 2024
- Reisen nach Zahlen – Tag 900
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (20) von Chichilaki bis zum Schutzvertrag von Georgijwesk
- Pflanzen, die es geschafft haben
- EIL: Wie man eine geschlossene Grenze überquert – auf dem Landweg von Georgien nach Aserbaidschan
- Reisen nach Zahlen – 1000 Tage
- Georgien – Winterschlaf im Schatten des Kaukasus
- Kurzanleitung: Mit dem Schiff von Aserbaidschan nach Kasachstan
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (21) von Avtovağzal bis Tamada
- А вы откуда? Mit dem Rad durch Aserbaidschan
- Wissenssplitter aus den Reisesteinbruch (22) von Aralkum bis Zoroastrismus
- Ratgeber: Wandern im Fan-Gebirge (Tadschikistan)
- Seitenstrasse – Seidenstrasse: Mit dem Rad vom Kaukasus nach Zentralasien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (23) von Aalam Ordo bis Yssyk-Köl
- Reisen nach Zahlen – 1100 Tage
- Elf Anekdötchen aus 1111 Reisetagen
- Ratgeber: Mit Rad, Baggage und Eisenbahn durch Zentralasien
- Mein Drei-Tage-China – der Ersteindrucks-Cocktail
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (24) von Apfel bis Yak
- Willkommen in Stania – die Fantastischen Vier Zentralasiens
- Reisen nach Zahlen – Tag 1200
- Die Mongolei – wie alles war, bevor alles begann
- Ratgeber: Südkorea und die besten Radwege der Welt
Sahel – bislang hätte ich dieses Wort ausschließlich mit dem Wörtchen Zone verknüpft und assoziierte damit einen so fernen wie riesigen Landstreifen, der sich südlich an die Sahara anschmiegte. Dementsprechend schmunzelte ich, als ich zu meinem ersten Live-Fußballspiel dieser Reise aufbrach. Der von mir beehrte Verein hörte nämlich auf den klangvollen Titel „Étoile Sportive du Sahel„. Nun gut, dachte ich bei mir, recht ambitioniert, die Herren, dass man sich über diese riesige Wüste hinwegträumt und nach den Sternen dahinter greift. Aber wie so oft ist die Wirklichkeit erheblich prosaischer als man gemeinhin annimmt. So erfuhr ich kurz darauf, dass ganz genauso auch ein Teil der tunesischen Mittelmeerküste genannt wird, von dem Sousse wiederum das Zentrum ist. Sehr verwirrende und unnötige Namensdoppelung meines Erachtens.
Earthbag, Superadobe, Sandsackbau – diese, mir zuvor gänzlich unbekannte Bauweise ist wie man sieht unter vielen, schillernden Namen bekannt. Doch ich sollte sie hier quasi von der Pike auf kennenlernen. Denn bei unserem ersten Arbeitseinsatz über wwoofing in Tunesien schippten wir Erde, mischten diese mit Kalk und Wasser um sie dann in Säcke zu pressen, um sie dann in wurstförmige Ringe zu verwandeln, die sich irgendwann zu einem Haus auftürmen sollten. Über diese spezielle Art des Hausbaus ließe sich nun einiges sagen. Die hervorstechensten und mich überzeugenden Eigenschaften sind hauptsächlich die Schlichtheit der Idee und natürlich die preiswerte Komponente der ganzen Angelegenheit. Weiterführende Informationen sind hier zu finden.

Auf dieses Stadtwappen fiel mein Blick während unseres einwöchigen Aufenthaltes in Sousse das ein oder andere Mal und ich habe Fragen. Leuchtturm, Olivenzweige, Segel, Meer – alles klar, aber was bitte ist dieses Zahnrad, Rotorblatt, Mühlstein in der rechten Bildhälfte. Und was hat es noch dazu mit Sousse zu tun.
Kommen wir nun zu etwas Agrarwissen: Im nebenstehenden Bild können gleich zwei uralte Tricks der Altvorderen bestaunt werden. Die Bewirtschaftung dieser schon immer sehr trockenen Gegend gelang unter anderem durch die Zuhilfenahme der Bodenbefeuchtung mittels einer mit Wasser gefüllten Amphore, welche man neben das Wurzelwerk der zu kultivierenden Pflanze versenkte. Man konnte hierfür sogar leicht salziges Wasser verwenden, dann musste die Amphore jedoch in regelmäßigen Abständen ausgegraben und gesäubert werden, was natürlich einem gewaltigen Arbeitsaufwand gleichkommt, aber in der Not eine Alternative darstellt. Der andere Trick sind die beiden Bäume, die hier in direkter Nachbarschaft gepflanzt wurden sind: Wein und Granatapfel bilden eine unglaublich enge symbiotische Gemeinschaft, so dass man schon früh darauf kam, diese gemeinsam zu pflanzen.



Bäume pflanzen am Rande der Wüste gehört in meinen Augen zu den sinnvollsten und sinnlosesten Tätigkeiten schlechthin. Da tut es gut, wenigstens so etwas wie eine gute Nachricht diesbezüglich zu erfahren. Der tunesische Staat, der von alle seinen Bürgern mit denen wir sprachen, nicht unbedingt positiv gesehen wird, hat zumindest eine außergewöhnlich nützliche Entscheidung getroffen und sogar umgesetzt. In der ersten Novemberwoche dürfen alle tunesischen Staatsbürger zu den Baumschulen des Landes fahren und sich unentgeltlich bis zu 1000 Jungbäume mitnehmen. Das ist eine derart simple und im wahrsten Sinne des Wortes fruchtbringende Maßnahme, dass ich kurz träumte, wie es wohl wäre, würden wohlhabende Staaten wie Deutschland oder Ungarn es Tunesien gleichtun.

Maghreb? Natürlich hat man dieses Wort schon mal gehört und kann es irgendwie grob einordnen, aber so richtig sicher ist man sich nicht. Mir ging es zumindest mit dem Maghreb so. Zumindest bis ich einen Teil von ihm bereiste, feststellte, dass ich in ihm war und nachschlug, um was es sich dabei denn nun genau handele. Das Wort (المغرب al-maghrib) hat arabischen Ursprung und bedeutet soviel wie ‚der Westen‘ (wörtlich „Ort, wo die Sonne untergeht“). Es gibt hierzu natürlich auch ein Gegenstück namens Maschrek (المشرق al-maschriq), was soviel heißt wie ‚der Osten, Orient‘ (wörtlich „Ort, wo die Sonne aufgeht“). Das kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Genau, es entspricht in etwa dem Orient-Okzident-Konzept.
Natürlich waren mir Agaven ein Begriff. Nicht nur als zentraler Bestandteil von Tequila, sondern auch als imposante Pflanzen am Wegesrand in südlichen Ländern. Doch ich lernte hier noch einiges dazu über diesen cleveren Überlebenskünstler. So beispielsweise, dass sie nur einmal in ihrem Leben blühen und dafür oft mehrere Jahrzehnte benötigen. Aus diesem Grund werden sie auch Jahrhundertpflanzen genannt. Auch, der elegante Clou ihres Fortpflanzungsmodells, dass der über Jahrzehnte aufgebaute Fruchtkörper als Schutz und Nährboden für die Nachkommen gedacht ist, war mir neu. Ich nutzte diese getrockneten Agaven sogar für meine Spezialmischung, mit der ich den von mir am Rande der Wüste gepflanzten Bäumchen, einen möglichst angenehmen Start in ihr entbehrungsreiches Leben bereiten wollte. Als ich dafür die Agavenstümpfe hackte, war ich zunehmend angetan von der fasrigen Struktur und dachte bei mir, dass man dieses Zeug doch auch bestimmt für andere Zwecke verwenden könnte. Bei diesem Gedanken verblieb ich für längere Zeit bis ich irgendwann drauf kam: Sisal! Da war also tatsächlich schon jemand vor mir drauf gekommen. Nagut.

Es gehört zu den vielen liebgewonnenen Traditionen unserer Reisen, dass abends im Zelt noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen wird. Seit einiger Zeit sind wir nun mitten in den Legenden um Jason und die Argonauten. Wie groß war unsere Vorfreude als wir realisierten, dass unser Held auch unser gegenwärtiges Revier, Tunesien, durchkreuzen würde. Voller Ungeduld durchschmökerten wir uns bis zu der betreffenden Stelle. Nur um dann zu erfahren, dass die Mannschaft ihr Schiff vom Nil durch ganz Lybien, durch den von uns gerade passierten (größten) Salzsee (der Sahara) bis zum Mittelmeer trug (!!!). Ohne jegliche Erklärungen. Nur um kurz darauf kommentarlos von der Küste abzulegen und, als wäre es das normalste der Welt, auf direktem Wege nach Griechenland zu segeln. In diesem Moment nahm ich vorsichtig Abstand von dem hehren Vorhaben, sich von den Reiseerfahrungen der Klassiker inspirieren zu lassen.
Beduine? Berber? Tuareg? Da wären wir wieder in der beliebten Kategorie: Begriffe, die man grob einordnen kann, wenn man aber genauer drüber nachdenkt, ganz schön unsicher wird. So ging es jedenfalls mir bei diesen dreien, mit denen ich in der durchradelten Region immer wieder in den verschiedensten Kontexten in Berührung kam. Mit dem Begriff Berber fühlte ich mich noch am sichersten. Das waren doch die ursprünglich hier in den Wüstenregionen lebenden Völker, die sich immer wieder mit den jeweiligen Zugezogenen, ob Phönizier, Römer oder Arabern in die Haare kriegten. Außerdem hatten sie diese abgefahrene Schrift, die ein wenig an extraterrestrische Schatzkarten erinnerte.
Kurz gesagt handelt es sich bei den Berbern um die „Ureinwohner“ Nordafrikas, also jene, die schon ein bisschen länger hier lebten als die Araber, Franzosen, Spanier oder wer immer sonst sich in letzter Zeit hier niedergelassen hat. Zwischen 40 und 70 Millionen von ihnen leben verstreut über die verschiedenen Länder, und obwohl sie mittlerweile relativ unauffällig in den jeweiligen Mehrheitsgesellschaften leben, unterscheiden sie sich doch kulturell, sprachlich, ja sogar in Sachen Religion gibt es trotz des angenommenen Islams gewisse Unterschiede zur Standardversion. Da die Bezeichnung Berber höchstwahrscheinlich vom griechischen Wort bárbaros abstammt, bezeichnen sich viele Berber als imazighen ‚Freie‘, um sich einerseits mit ihrer Muttersprache zu bezeichnen, andererseits die als abwertend verstandene Fremdbezeichnung „Berber“ loszuwerden. Oder man benutzt einfach die Namen des jeweiligen einzelnen Volksstammes, zum Beispiel Rifkabylen oder eben Tuareg.
Womit wir elegant zum zweiten Begriff gesprungen wären. Die Tuareg sind ein Berbervolk, welches ursprünglich im Fessan (Region in Lybien) lebte und im 11. Jahrhundert von arabischen Beduinen (Achtung, nächster Begriff) in die Sahara vertrieben wurden, wo sie ihrerseits das Wüstenvolk der Tubbu vertrieben. Auf diese Weise konnten sie sich der Arabisierung ihrer Kultur ein wenig entziehen und versuchten über die Jahrhunderte ihre Lebensweise zu verteidigen. Und über einen der zahlreichen Konflikte, in denen die Tuareg in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit wie auch in gegenwärtigen Auseinandersetzungen sich engagierten, muss ich sie kennengelernt haben. Als ich mehr über sie las, kam mir auch die Sache mit dem „blauen Ritter der Wüste“ vage bekannt vor, doch dass dies vom, durch jahrelanges Tragen des indigogefärbten Kopftuchs (Aleschu) kommen soll, welches die Kopfhaut leicht bläulich färbte, das war mir definitiv neu.
Kommen wir nun zum letzten Begriff, und zwar den Beduinen. Glücklicherweise kann man hier gewaltig abkürzen und es schlicht auf folgende Weise zusammenfassen: Bei Beduinen handelt es sich um nomadisch lebende Araber. Man könnte das jetzt noch etwas lokal eingrenzen und historisch einordnen, aber das kann bei Interesse jeder selbst nachschlagen. Wichtig für diesen kleinen Wissenssplitter bleibt nur die Erkenntnis, dass sie mit den zwei vorgenannten Begriffen nicht zusammengehören obwohl sie doch soviel miteinander gemein haben.

Zahlen an der Wand. Immer wieder. 1-161. Ein rätselhaftes Phänomen in Tunesien, welches wir erst kurz vor Schluss entschlüsselten. 
Zwei Kandidaten können auch zuviel sein
Anfangs hielt ich es für irgendwelche Schmierereien oder ein Kinderspiel. Doch bald erkannte ich: Es hat System! Immer an staatliche Gebäuden, so diese eine weiße Wand hatten, waren fein säuberlich Kästchen gezeichnet, die mit den Ziffern 1 bis 161 ausgefüllt waren. Wir hatten keinerlei Idee. Doch ein paar Rückfragen bei Einheimischen brachten die simple Lösung. Es gibt 161 Sitze im Parlament und bei Wahlen sollten die jeweiligen Kästchen mit den betreffenden Kandidatenposter sowie seinem Programm/Wahlversprechungen plakatiert sein. Der Umstand, dass wir während einer Wahl bereits in Tunesien waren und keinerlei Bildchen an der Wand bemerkten, beweist einmal mehr den Charakter dieser Scheinwahl mit seiner Wahlbeteiligung von gerade mal 8,8%.
Wüste. Es ist warm. Kilometer reiht sich an Kilometer. Schnurgerade zieht das ereignisarme Land an einem vorbei. Der Blick flattert müde über die karge Ebene bis er an einer Unregelmäßigkeit hängen bleibt. Es sieht wie ein Durchwurfsieb aus, etwas womit man Erde, Kies oder Sand filtern kann. Gerade beim Bau des Eartbugs (siehe oben) kam diese Innovation zum massiven Einsatz. Aber hier? In der Sahara? Dieser feine Staub, der sich in die Unendlichkeit des Horizonts wälzte, war doch bekanntlich für jedwede Verwendung komplett wertlos. Irritiert fuhr ich weiter und übergab diese Beobachtung den allzeit beredten Experten von Twitter.
Und siehe es gab eine Lösung für diese wüste Erscheinung, welche ebenso klar als wie naheliegend war: Man sucht nach Sandrosen.


(linkes Bild: Wikipedia)
Entdecke mehr von Viva Peripheria
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
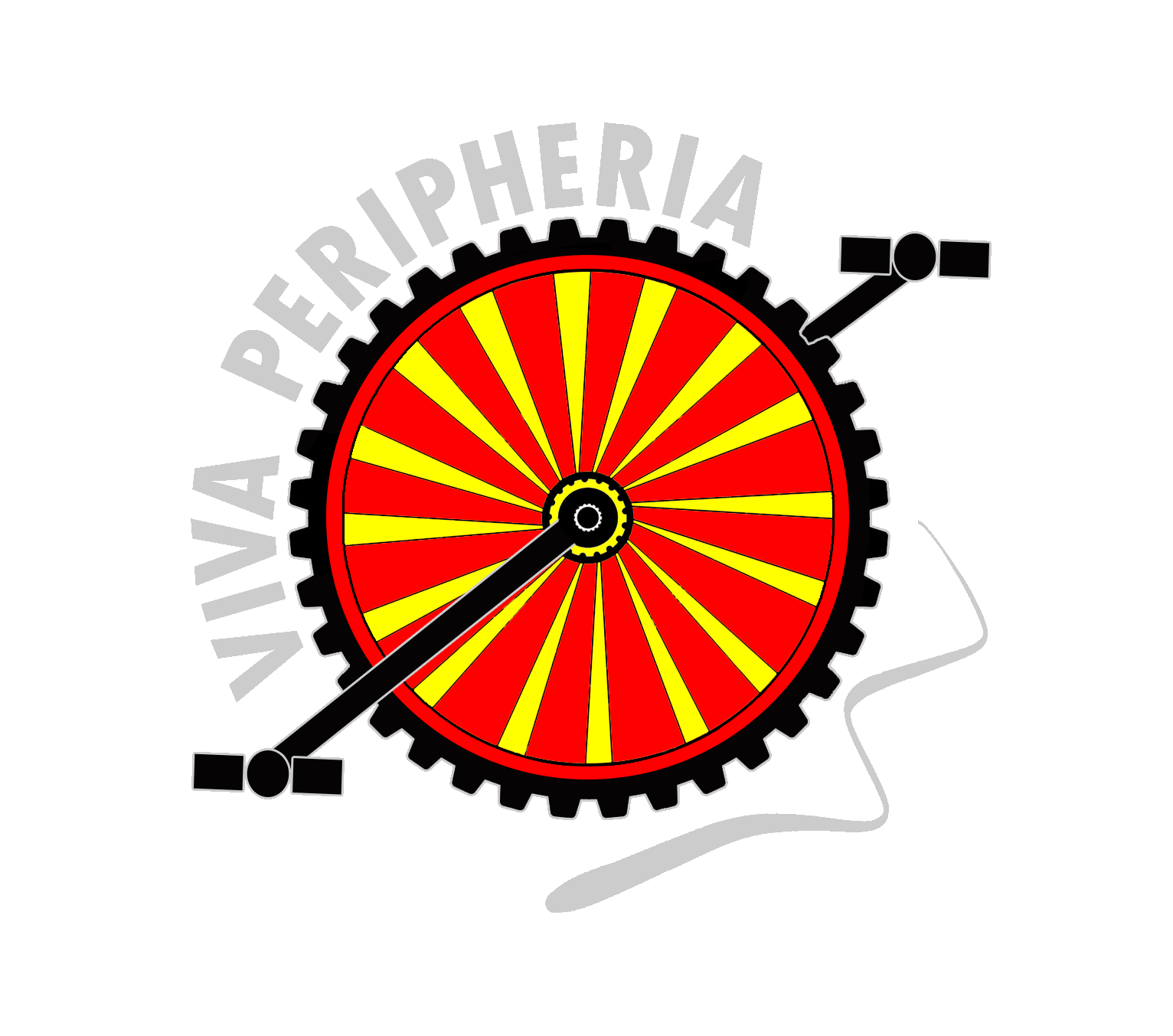







So eine nationale oder gar weltweite Baumpflanzaktion wäre wirklich toll. Mit schulfrei natürlich!
Ich war ein paar Mal auf Jugendaustausch in Israel, und da haben wir immer Bäume in der Wüste gepflanzt. Aber es war schon alles ausgebuddelt und vorbereitet, als wir ankamen. Wir mussten nur noch ein bisschen Erde ins Loch schaufeln und gießen, wie so Politiker.
Später ist eh alles abgebrannt. Und wenn nicht, hätte irgend so ein Doldi eine Schnellstraße zu einer höchstens halblegalen Siedlung hingebaut. Das sind wahrscheinlich die gleichen Fortschrittsfreaks, die Zahnräder in Wappen pflanzen.