- Warum es wieder losgeht oder eine neuerliche Hamsterradkritik
- Von Friedrichshain über Friedrichshain hin zu böhmischen Dörfern
- Von tschechoslowakischen Höhen und Tiefen
- Diashow, die erste: Von Heidesee bis fast zum Triglav
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (1) von Altungarisch bis Walachei
- Über idyllische Plattitüden und endloses Grün
- Über das januszipfelige Istrien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (2) von Adige bis Theodor Mommsen
- Reisen nach Zahlen – 100 Tage
- Von einer die auszog das Fürchten zu verlernen
- Der italienischen Reise erster Teil
- Die besten Gerichte von draussen
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (3) von Basilikata bis Wildschwein
- Der italienischen Reise zweiter Teil
- Der italienische Reise dritter Teil
- Einblicke ins Reisetagebuch
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (4) – Von Ätna bis Zitrusfrüchte
- Reisen nach Zahlen – Tag 200
- Währenddessen in Afrika
- Così fan i tunisini
- Eisenbahnfahren in Tunesien
- Von Menschenhaufen und anderen Platzhengsten
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (5) von Agave bis Tuareg
- Tunesien – auf der Suche nach der Pointe
- Reisen nach Zahlen – Tag 300
- Sardinien – der italienischen Reise letzter Teil?
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (6) von Asinara bis Tafone
- Kleine, feine Unterschiede
- Im Autokorsika über die Insel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (7) von Elba bis Tarasque
- Fahrradfahren (u.v.m.) wie Gott in Frankreich – erste Eindrücke
- Jahrein, jahraus, jahrum
- Ausrüstung für Langzeitreisende – ein paar grundlegende Gedanken
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (8) von Baselstab bis Wasserscheidenkanal
- Reisen nach Zahlen – Tag 400
- Querfeldein und mittendurch – Frankreich vom Rhein bis zum Atlantik
- Wissensstrandkörner aus dem Reisewatt – Gezeiten-Sonderausgabe
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 (Frankreich)
- Projekt-Radria-Gleiche (Tag 426)
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (9) von El Cid bis Wanderdüne
- Der Jakobsweg – ein fader Pfad im Kurzporträt
- Ratgeber: Fahrradfahren auf dem Eurovelo 1 (Velodyssée)
- Unter Jakoblingen – von den Pyrenäen bis ans Ende der Welt
- Wissensplitter aus dem Reisesteinbruch (10) von Don Sueros de Quiñones bis Saudade
- Reisen nach Zahlen – 500 Tage
- Kopfüber durch Portugal und zurück
- Aus dem Reiseplanungslabor: Arbeitskreis Westafrika
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (11) von Azulejos bis Wasserballastbahn
- Meerdeutigkeit
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (12) Von Al-Andalus bis zu den Säulen des Herakles
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (13) von Alcazaba bis zur Unbefleckten Empfängnis
- Andalusien – ein Wintermärchen
- Reisen nach Zahlen – 600 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (14) von Flysch bis Trocadéro
- Rowerem przez peryferie
- Von Aisha Qandisha bis Moulay Idriss (15) Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch
- Jauchzend betrübt – die Packungsbeilage für Marokko
- Marokkohochjauchzende Menüvorschläge
- Reisen nach Zahlen – 700 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (16) von Corniche bis zur Via Domitia
- Die „Reiß-dich-am-Riemen“-Tour oder Radwandern für Durchgeknallte
- Ratgeber: Radfahren auf dem Eurovelo 8 – „La Méditerranée“
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (17) von Bektaschi bis Vučedol
- Giro della Jugoslavia
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 – das Balkankapitel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (18) von Chinesischer Jujube bis Ъъ
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch – MYTHOLOGIESPEZIAL – eine kleine Umschau des Irrsinns
- Was wurde eigentlich aus dem Römischen Reich? Eine ausführliche Inventur der verbliebenen Provinzen
- 852 Tage – Doppelt hält besser
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (19) von Atatürk bis Tigris
- Von Bačka Palanka zum Goldenen Vlies – Endspurt zum Kaukasus
- Z Nysy do Nysy
- Jahresrückblick 2024
- Reisen nach Zahlen – Tag 900
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (20) von Chichilaki bis zum Schutzvertrag von Georgijwesk
- Pflanzen, die es geschafft haben
- EIL: Wie man eine geschlossene Grenze überquert – auf dem Landweg von Georgien nach Aserbaidschan
- Reisen nach Zahlen – 1000 Tage
- Georgien – Winterschlaf im Schatten des Kaukasus
- Kurzanleitung: Mit dem Schiff von Aserbaidschan nach Kasachstan
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (21) von Avtovağzal bis Tamada
- А вы откуда? Mit dem Rad durch Aserbaidschan
- Wissenssplitter aus den Reisesteinbruch (22) von Aralkum bis Zoroastrismus
- Ratgeber: Wandern im Fan-Gebirge (Tadschikistan)
- Seitenstrasse – Seidenstrasse: Mit dem Rad vom Kaukasus nach Zentralasien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (23) von Aalam Ordo bis Yssyk-Köl
- Reisen nach Zahlen – 1100 Tage
- Elf Anekdötchen aus 1111 Reisetagen
- Ratgeber: Mit Rad, Baggage und Eisenbahn durch Zentralasien
- Mein Drei-Tage-China – der Ersteindrucks-Cocktail
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (24) von Apfel bis Yak
- Willkommen in Stania – die Fantastischen Vier Zentralasiens
- Reisen nach Zahlen – Tag 1200
- Die Mongolei – wie alles war, bevor alles begann
- Ratgeber: Südkorea und die besten Radwege der Welt
- Ratgeber: Osaka-Shanghai per Schiff
- Japan – selten so gelacht!
- Le Grand Prix de l’Asievision – die besten Ohrwürmer vom Kaukasus bis Japan
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (25) von 108 bis མཐུན་པ་སྤུན་བཞི།
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (26) Japan-Spezial
Die Sonne versinkt langsam und humorlos im Mittelmeer, ganz genauso wie sie es auch auf der anderen Seite getan hatte. Ein lauer Wind weht uns durch die Haare und wir vergraben die Füße im groben Sand Sorrentos. „Das war es dann also,“ raunt die Liebste mit gleichermaßen erschöpften wie glücklichen Blick aufs Meer, „da wären wir also wieder zurück aus dem Ausland. Wir sind wieder zu Hause.“
Diese Aussage, knapp und pointiert, ließ mich aufmerken. Ja, tatsächlich war an diesem Fazit etwas dran. Doch so schön die eine Seite der Medaille ist, und zwar dass zumindest wir Europa von Lissabon bis Moskau, von Rekyavik bis Famagusta als unser Zuhause empfinden, so kompliziert ist der andere Teil der Empfindung, dass ein paar Fährkilometer weiter südlich etwas begänne, was wir als Ausland empfinden. Dabei sehe ich den Begriff Ausland nicht einmal als negativ an, nicht im geringsten. Ihm haftet eher etwas Fremdes, nicht verständliches, anderes an. Etwas was ich früher sicher noch mit Ländern verband, die meiner Herkunftsregion deutlich näher lagen. Noch vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten hätte ich eine Reise nach Bulgarien oder Portugal ohne zu zögern als Auslandsreise bezeichnet. Heute ist dies nicht mehr so. Zu sehr haben wir uns aneinander gewöhnt und angeglichen. Natürlich gibt es noch Unterschiede jeglicher Art, die gibt es ja selbst noch in Deutschland, aber es ist nicht dieser Unterschied, dieser Kontrast auf den wir ab unserem ersten Tag in Tunesien trafen.
Die folgenden Betrachtungen erfordern daher dieses Mal eine etwas ausführlichere Einleitung. An fast jedem Tag unseres zehnwöchigen Aufenthalts hier erlebte ich etwas, dass mich ächzen ließ: Wie sollte ich all dies nur halbwegs passabel vermitteln? Wie abgehoben war ich, dass ich nun tatsächlich versuchen wollte, etwas zu beschreiben, was ich schon damals schwer zu fassen fand? Sehr oft sah ich mich hier in Situationen versetzt, die mir schlicht keine andere Wahl ließen als dümmlich zu grinsen und dem innerlich gähnenden „Hää?“ zu frönen. Es war diese Grundstimmung, welche zu dem oben stehenden Titel führte. Oftmals fühlte ich mich hier einfach auf dem Schlauch stehend, die Pointe nicht begreifend, ja nicht mal ganz sicher seiend ob es sich überhaupt um einen Witz handelte.

Selbstverständlich bin ich mir bewusst, dass auch meine sonstigen Exkurse nie und nimmer die Wirklichkeit in den betreffenden Landstrichen nur annähernd abbilden können. Das wäre vermessen. Aber ich denke schon, dass es mir manchmal gelang, ein gewisses Stimmungsbild wiederzugeben, welches nicht ganz daneben lag. Im Falle von Tunesien muss ich offen erklären: Dieser Bericht wird strotzen vor Lücken, Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Desweiteren hadere ich ein wenig mit dem Umstand, dass einige meiner Beobachtungen, eventuell, wenn man sie in den falschen Hals bekommt, als herablassend, arrogant oder im abwegigsten Falle gar als rassistisch gelesen werden könnten. Ich habe lange darüber nachgedacht ob ich diese Dinge daher einfach weglassen sollte, habe mich aber dagegen entschieden. Ich lasse es einfach bei der Bitte bewenden, mich nicht missverstehen zu wollen und hinzunehmen, dass die Dinge manchmal so sind wie sie sind, bzw. ich sie so wahrgenommen habe.
Kommen wir nach dieser langen und mühsamen Vorrede nun endlich zum Kern des Pudels. Tunesien! Ich hoffe, ihr habt heute nicht mehr viel vor (denn es könnte etwas länger dauern), lehnt euch zurück und lasst mich beginnen.
Die Reiseroute (grob zusammengefasst) von Tunis an der Küste hinab in die Wüste und zurück
Schon in der Frühphase der Planungen für diese Reise war Tunesien von uns als ideales Winterdomizil auserkoren. Nachdem wir auf der letzten Reise mit Zypern und der Türkei zumindest klimatisch eher mittelmäßig zufrieden waren, sollte es Tunesien nun reißen. Wir erwarteten kein T-Shirt-Wetter, aber ein trockenes, größtenteils mildes Asyl während der radunfreundlichsten Jahreszeit. Was wir bekamen war Regen, Regen und eisigste Temperaturen. Bis Mitte Januar hatten wir noch in Palermo verweilt und konnten uns kaum losreißen von dieser neuentdeckten Schönheit. Auch die unerwartet frühlingshaften Temperaturen machten uns den Abschied schwer. Denn pünktlich mit unserem Eintreffen kippte das Wetter und es wurde kalt, regnerisch und ungemütlich. So entschleunigte das Wetter unsere Mobilität logischerweise ein wenig. Wir verbrachten Zeit in billigen Hotels in Tunis, Nabeul und Sousse und ergänzten das Warten auf besseres Wetter mit Arbeitseinsätzen mittels wwoofing in der Nähe von Mornag und Menzel Kamel.











Nach unserem letzten Arbeitseinsatz schien der afrikanische Winter am Ende seiner Kräfte zu sein und mit jedem Kilometer, den wir südlicher fuhren, wurde er zusätzlich schwächer. Die Tour, die jetzt begann sollte zu den beeindruckendsten und tollsten Wochen unseres Aufenthalts in Tunesien gehören. Wir fuhren nah an die Wüste heran, tingelten die Oasen ab, ritten auf Kamelen und schliefen schlussendlich eine Nacht in der Wüste und mehrere weitere in einer vom Sandsturm heimgesuchten Oase. Schließlich radelten wir bis nach Gabes, ließen Djerba links liegen und fuhren mit der Eisenbahn zurück nach Tunis, von wo wir wenige Tage später mit der Fähre gen Salerno abfuhren.
Vorhang auf für die große Show des „Yea“ and „Nay“ für Tunesien
Wie nähert sich der auf Harmonie getrimmte Berichterstatter nun am besten einem kontroversen Thema? Genau, mit einer grundlegenden Plus-Minus-Liste. Beginnen wir mit einem der schönsten Dinge, die uns fast vom ersten Tage hier auf- und nahezu in den Schoß fielen.
Gastfreundschaft. Dieses, banale Wörtchen, welches mittlerweile wohl in jedem verfügbaren Reiseführer zu fast jedem Land südlich der Alpen zu finden ist, greift aber für Tunesien definitiv zu kurz. Es ist ein allumfassenderes, sich sorgendes und kümmerndes Grundgefühl, welches einem als Fremden hier entgegenschlägt und mit fordernder Güte so leicht nicht wieder loslässt. Selbstverständlich betrifft das hauptsächlich das Land und kleinere Städte, und auch hier speziell den Süden, aber auch in den größeren Städten ist man stets im Fokus des öffentlichen Interesses. Nirgends auf all meinen Reisen hörte ich so oft wie hier einen Willkommensgruß. Ob von Kindern in der Medina, Händlern, Busfahrern oder zufällig an einem vorbeistreifenden Leuten – immer wieder hörten wir ein offensichtliches erfreutes und bedingungsloses „Bienvennue e Tunisie!“. (Wohlgemerkt, zum überwiegenden Teil handelte es sich hier um männliche Einwohner, aber dazu später mehr). Die Gastfreundschaft der Tunesier, wenn wir uns der Sache wegen auf diese blasse Bezeichnung einigen wollen, hat, so denke ich, ihre Grundlage in dem heißblütigen und unbeirrbaren Willen, dem Fremden, den Aufenthalt in ihrem Land so angenehm wie möglich zu machen. Man weiß um die Engpässe, Kümmernisse und Widersprüche des Heimatlandes und sucht diese durch eigenes Engagement für den Gast ungeschehen zu machen. Eine Aufzählung der Beispiele dieses, uns teils beschämenden Altruismus, wäre schier endlos, doch noch im Moment des Niederschreibens erinnere ich etliche Gesten voller Herzenswärme und Güte, die mich immer wieder aufs Neue überraschten und stets mit bitterer Hartnäckigkeit daran erinnerten wie es einem tunesischen Radfahrerpärchen in meinem Herkunftsland wohl gehen würde.
Und so war es diese Aufmerksamkeit, die uns, als wir nach 72 Tage Tunesien wieder „zu Hause“ in Italien ankamen, eine der Dinge, die uns sehr schnell fehlte. Hier waren wir wieder im Inkognito-Modus, Kunden im Dolce-Vita-Paradies. Die Italiener lächelten freundlich, grüßten bisweilen, aber im wesentlichen schauten sie durch uns hindurch so wir nicht etwas von ihnen kaufen wollten. Hier gehörten wir nicht mehr zur Familie, keiner interessierte sich sonderlich für uns, hier wurden wir als die Fremden behandelt, die wir auf der anderen Seite tatsächlich waren. Dabei hatte ich genau diesen „Inkognito-Modus“ in den ersten Wochen in Tunesien oft zurückgesehnt, denn gerade diese edle Eigenschaft hat natürlich auch ihre Schattenseiten. Denn wenn man nicht als extrovertierte Rampensau gezeichnet ist, dann gewinnt man eben nur bedingt Freude an dem Umstand, dass man, wo auch immer kurz anhält, im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht. Selbst ohne Fahrräder sorgte schon ein kurzes Innehalten und umschauen oft für eine hilfsbereite Anfrage von Passanten
Und damit wären wir schon mittendrin bei einem eindeutig als Minus wahrgenommenen Phänomen, dem hektischen Übereifer. So zahlreich die Hilfsangebote auch waren, so hatten sie doch oft auch eine impulsive, ja ungeduldige Note. Man wollte viel geben, aber immer auch schnell. ‚Wir kommen mit unseren Fahrrädern und Gepäck die Treppe zu deinem Haus nicht so leit runter. Klar kommt ihr das. Passt auf! Und, kracks.‘ Dabei fiel uns zudem oft auf, dass so leidenschaftlich und schnell ein Hilfsangebot zustande kam, es auch genauso schnell wieder fallengelassen wurde. Es war dies eine seltsame Eigenschaft vieler Tunesier, die uns bald auch in anderen Zusammenhängen auffiel: Sie waren schnell ablenkbar, unkonzentriert und hatten daher Schwierigkeiten, selbst kleine Dinge zu Ende zu bringen ohne sich von einer anderen Sache aus dem Konzept bringen zu lassen. Ob auf dem Markt, auf Ämtern, bei normalen Gesprächen, in den unterschiedlichsten Situationen bemerkten wir diese Besonderheit. Eben noch standen wir im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und die eine Sache, die es zu verhandeln ging ebenso, dann kam eine weitere Person hinzu, fragte irgendetwas und wir waren auf einmal Luft. Irritiert steht man dann wie bestellt und nicht abgeholt herum und wartet bis einem die Aufmerksamkeit eventuell wieder zuteil wird. Aber wenn man sich nicht aktiv darum bemühen würde, bliebe diese Hoffnung meist unerfüllt. Der wieder eroberte Gesprächspartner schaut einen dann meist etwas erstaunt an und widmet sich dem selben Thema mit deutlich weniger Leidenschaft. Im Schlepptau dieser Kontakte, so schien es mir manchmal, gab es auch oft genug Kontaktversuche und Gesprächsangebote aus heiterem Himmel von wildfremden Menschen, die dann nach den bizarrsten Gesprächseinstiegen erwartungsfroh vor einem standen und ebenso Grundlage für den Stoßseufzer wurde, der sich schließlich im Titel dieses Artikels wiederfand.
Und dann wäre da noch: All die Unkompliziertheit, die Offenheit für eine mögliche Ausnahme wenn es halt nicht anders ging – das gefiel uns nicht nur sehr, nein, das ging uns auch ein wenig ins Blut. Das bewies eindrücklich der Besuch bei der Deutschen Botschaft zum Ende unseres Aufenthalts in Tunesien. Wir waren hier um eine Dokument abzuholen, welches schon seit Wochen für uns bereit lag. Obwohl wir innerhalb der Öffnungszeiten da waren, hatte man bereits geschlossen. Ramadan. Klar. Nein, man selbst faste natürlich nicht, aber die Mitarbeiter. Das verstände sich doch von selbst. Die Mitarbeiter, die unseren Disput mit der deutschen Beamtenseele die ganze Zeit voller Pein und Mitgefühl beobachteten? Ja, die nicht, aber es gebe schon welche und man müsse sich schon an die Kultur eines Landes anpassen. Wir würden dies versuchen, doch wir wären den langen Weg mit dem Rad hergekommen, das Dokument liege doch schon bereit. Könne man da nicht? Keine Chance? Da regte offensichtlich allein schon die Frage auf.






Zum Abschluss dieser kleinen Einstimmung muss ich nun zu dem vielleicht schwerwiegendsten Negativmoment Tunesiens kommen. Es muss aufs Tapet, denn über kaum etwas redeten wir mehr, an nichts anderem verzweifelten wir mehr: Die Rede ist von Müll. Müll in epischen Ausmaßen, omnipräsent und landschaftsgestaltend. Ich könnte mir an diesem Punkt eine gewisse gleichermaßen ermüdete wie mitleidige Geste des Lesers vorstellen: ‚Ja, sicher. Müll, kennen wir. DAS Problem unserer Zeit. Und dann außerhalb der EU, in einem Entwicklungsland, in Afrika. Große Überraschung!‘ Nein, nein und nochmals nein. Ich muss hier mit aller mir zur Verfügung stehenden Autorität reingrätschen. Das hier war etwas anderes, es hatte Ausmaße, die mich nicht nur anekelten oder verzweifeln ließen wie ich es auf vielen meiner Reisen am Rande der Gesellschaft oft genug erlebt habe. Denn was mich erschütterte war weniger die Masse an Müll, sondern vielmehr die lückenlose Allgegenwart desselben sowie die Gleichgültigkeit der Menschen ihm gegenüber. Brennende, wilde Mülldeponien, stapelweise Unrat am Straßenrand, am Strand oder in öffentlichen Parks nehmen in vielen von uns durchreisten Ländern in galoppierenden Tempo zu, doch in all diesen Ländern gab es stets Orte, die mehr oder wenig emsig gereinigt wurden. Selbst im ärmsten Süden Italiens fand man ein Centro Storico, in der Türkei eine Moschee oder im Wedding manchmal eine Parkbank mit geleerten Mülleimer. Derlei safe spaces gibt es im Müllstrudel Tunesiens nicht. Ob Park, Café oder Moschee – überall traf man auf Müll, Schmutz und Verwahrlosung. Sicher, im Privaten sorgte man sich peinlich um Reinlichkeit, aber außerhalb dieses Raums gab es kaum einen Platz, der zum Verweilen einlud. Wir begriffen das erst so richtig als wir durch das Land radelten. Unsere Praxis ist es in regelmäßigen Abständen zu rasten. Meist sind dies schöne Orte, mit Blick, vielleicht einer Bank. Doch die Etappen durch Tunesien verliefen anfangs recht rastlos. Die meisten Bänke in Parks oder an Stränden waren in miserablen Zustand und von, ihr ahnt es, Müll übersät. Der öffentliche Raum des Tunesiers schien das Café zu sein. Aus Mangel an anderen Angeboten nahmen auch wir dieses Angebot bisweilen wahr. Doch so richtig wohl fühlten wir uns hier, an ungeputzten Tischen, zwischen ungeleerten Aschenbechern selten. Schnell wurde der Ausspruch: ‚Tunesien sei kein Land der schönen Pausen‘, eine geflügelte Redensart unter uns. Abseits der Cafés war es aber eben oftmals auch die Straße, auf welche sich die Männer eines Dorfes setzten um dann mitten im Müll miteinander zu schwatzen. Man verzeihe mir meinen von Unverständnis triefenden Abscheu, ich begreife mich wahrlich auch nicht als einen Menschen, für den Ordnung und Sauberkeit zu den elementarsten Werten gehören, aber wieso diese großartigen, herzensguten Menschen, die offensichtlich über so viel Zeit verfügten, es nicht im Bereich der Möglichkeiten sahen, sich ein kleines Stück Straße zu fegen, ein paar Bretter und Steine zu einer Bank zu zaubern, das habe ich einfach nicht verstanden. Das Positive ist nun, dass es sich hierbei um die einzige unangenehme Sache handelt, die ich in Tunesien nicht verstanden habe. Und zumindest in der Wüste war alles wieder gut, denn dies war dafür einer der saubersten Orte, welchen ich je die Ehre hatte, besuchen zu dürfen.










Es gäbe noch etliches mehr, was erwähnenswert wäre, aber unter den bestimmenden Dingen, die uns hier auffielen und die ähnlich wie der zuvor beschriebene Müll alles andere überdeckte, war noch eine Sache und zwar ein mir bislang unbekanntes Ausmaß an Mangel und Armut dem ich hier begegnete. Zugegeben, in wirklich arme Länder habe ich mich nie gewagt und auch Tunesien gehört zweifelsohne nicht in diese Kategorie. Dennoch sah ich mich hier einer ökonomischen Realität ausgesetzt, die ich so noch nicht kannte. Es hatte nur zum Teil mit dem zu tun woran man Armut im klassischen Sinne zu erkennen glaubt. Also der Kleidung und sonstigen „Ausrüstung“ der Menschen, ihren Häusern und Autos, wie, was und wie viel sie einkaufen, mittellose Menschen in der Öffentlichkeit. All diese Indikatoren sprachen schon auf den zweiten Blick in der Hauptstadt eine deutliche Sprache. Obzwar Bettelei im öffentlichen Raum sehr diskret ablief, war sie allgegenwärtig, die gesamte Infrastruktur machte einen verlotterten und nur notdürftig geflickten Eindruck und sämtlicher Besitz der Menschen schien wie von der Resterampe eines Ramschladens aus der ersten Welt gefallen zu sein. Doch bei aller Heftigkeit dieses Eindrucks, diese Form der Armut kannte ich bereits von anderen Ländern am Rande des Wohlstandskuchens. Doch in Tunesien kamen noch ein paar Sachen hinzu. Und damit meine ich nicht nur die regelmäßigen Versorgungsengpässe von bspw. Kaffee, Öl, Zucker oder Milch, die die Bevölkerung unter Druck setzen, sondern vielmehr die gesamte, für mich sichtbare Wirtschaftsstruktur. Diese unterscheidet sich meines Erachtens in einigen Punkten elementar von allen mir bislang bekannten Systemen. Was ich meine ist folgendes: Wie die meisten Länder abseits der Wohlstandskernzonen werden auch hier die vorgelebten Formen des Konsums mittels Supermarkt, Shopping Mall und Onlineshopping nur halbherzig imitiert und angenommen. Die Hauptschlagader der Ökonomie pulsiert weiterhin auf den Basaren und in den zahllosen Straßengeschäften. Die übersichtliche Anzahl an Produkten, die man hier erwerben kann, zeichnet sich dabei oft durch eine Minderwertigkeit aus, die mich überraschte, aber dadurch erklärt wurde, dass alles von hoher Qualität in die „Erste Welt“ exportiert würde.

Soweit so bekannt. Ähnliches bis Vergleichbares hatte ich auch anderswo schon erlebt. Doch gab es in diesen Fällen immer eine parallele Konsumgesellschaft, wo man für exorbitant hohe Preise die westliche Konsumgesellschaft auferstehen lassen konnte. Dieses Intershop-Konzept fand sich in der einen oder anderen Variation in den meisten wackligen Volkswirtschaften, die ich bislang besuchte. Jn Tunesien, das fiel mir erst auf den dreizehnten bis zweiundzwanzigsten Blick auf, gab es so etwas nicht. Sprich, die Supermärkte simulierten nur das westliche Kaufgefühl, die überbordende, dekadente Vielfalt suchte man hier aber vergebens. Die riesigen, mir bekannten Supermarktgebäude wirkten apokalyptisch: abgedunkelt, leer, Regale, die zwar voll waren, aber mit wenigen verschiedenen Produkten nur vorgaukelten, mehr bieten zu können als jeder kleine Laden draussen auf der Straße. Das gleiche betraf Restaurants und Geschäfte, die mit westlichem Interface lockten, aber meist nur Mangel und Einseitigkeit boten. An sich fand ich dies gar nicht so übel, da mir die Fülle an Angeboten in Europas Regalen oftmals unnötig und vulgär erscheint. Doch diese Leere hier bestand aus anderen Gründen als aus denen der Nachhaltigkeit. Ich war perplex als ich realisierte, dass ich mich in einem Land, welches von relevanten Warenströmen nahezu abgeschnitten ist, befand. Natürlich konnte man alles bestellen, aber zu deutlich höheren Kosten. Immer wieder erlebte ich daher hier Überraschungen, die mit dieser Versorgungslage zusammenhingen. Ob es das rudimentäre, historisch anmutende Werkzeug bei der Landarbeit war oder die miserablen Materialien waren, die beim Hausbau verwendet wurden, immer wieder aufs neue begriff ich wie grundlegend abgekoppelt und dabei gnadenlos abhängig diese ehemals koloniale Wirtschaft doch war. Wobei ich dieses „ehemals“ immer argwöhnischer beäugte. Dabei wohnt diesem Umstand natürlich auch etwas Gutes inne. So wird hierdurch nicht nur das Improvisationstalent gefördert, nein ganze Berufsstände und Fähigkeiten bleiben quer durch weite Bevölkerungsteile erhalten. Sprich, wenn hier was kaputt geht, findet man jemanden der es repariert oder eine andere findige Lösung präsentiert, und wegschmeißen, neu bestellen gehört mit Sicherheit nicht dazu. Diese flexible Autonomie, die der Mangel gebiert, kenne ich auch aus anderen Weltenecken. Doch ich halte mich mit meiner Bewunderung stets ein wenig zurück, da ich im Hinterkopf habe, dass all dies, ähnlich wie das zuvor beschriebene, begrenzte Konsumangebot, nicht auf freier Entscheidung beruht. Andererseits: Braucht es für solch sinnvolle aber den Luxus einschränkende Dinge wie Kreislaufwirtschaft und einer Beschränkung der Produktauswahl nicht immer etwas Zwang?
Ein kurzes Wort zu Frauen: Denn die meisten hier beschrieben Einschätzungen und Beobachtungen gehen auf Erfahrungen mit Männern zurück. Dabei wirkten die Situation auf den ersten Blick mehr als entspannt. Als wir unsere ersten Gehversuche in Tunis unternahmen, waren wir mehr als angetan. Das Straßenbild zeigte eine fröhlich und bunt gemischte Bevölkerung, dabei Frauen ohne Schleier oder Kopftuch, laut lachend und unbeschwert den Tag genießend. Doch das war tatsächlich nur eine sehr oberflächliche Wahrnehmung. Mit der Zeit bemerkten wir, dass Frauen in der Öffentlichkeit deutlich weniger zu sehen waren. In den Cafés saßen Männer, auf den Märkten handelten Männer, in den Geschäften waren Männer, Hotels, Restaurants – Männer. Und wer saß auf der Straße und plauderte entspannt miteinander? Große Überraschung – Männer! Frauen blieben im Hintergrund, zu Hause. Wenn dann sah man sie bisweilen in großen Trauben gemeinsam unterwegs. Zumeist im Zusammenhang als Schülerinnen oder Studentinnen, aber das für uns so gewöhnliche gemischtgeschlechtliche Abhängen, in welchem öffentlichen Kontext auch immer? Fehlanzeige.
Wenn ich zum Ende dieser kleinen Vor- und Nachteile-Show noch ein paar Worte zum allgemeinen Charakter des Landes verlieren darf, dann muss meines Erachtens zuallererst auf den Unterschied zwischen Norden und Süden eingegangen werden. An sich ist Tunesien ja, speziell im direkten Nachbarnvergleich ein relativ kleines Land. Und trotzdem reicht es fast um von zwei verschiedenen Ländern zu sprechen. Möglicherweise hat das, was uns im Süden auf- und gefiel auch eher seine Ursache im Stadt-Land-Gefälle. Der Norden ist von der Hauptstadt und eigentlich bis Sousse von Städten geprägt. Daher fühlt man sich hier eher anonym, die Medinas sind hektischer, lauter. Im Süden wird es deutlich ländlicher, unaufgeregter und obwohl die Menschen hier deutlich wortkarger sind, sagen sie dennoch mehr. Auch die Vegetation unterstreicht diese Unterschiede: Das grüne Hügelland des Nordens mit den riesigsten Olivenmonokulturen die ich bis jetzt gesehen habe, gegenüber den lebensfeindlichen Weiten der Salzseen, Steppen und Wüsten des Südens. Beide Seiten Tunesiens gefielen uns, auch wenn wir jeden Tag aufs neue die drohenden Anzeichen der kommenden Veränderung erleben durften. Neben der bereits erwähnten Vermüllung leidet die ehemalige Kornkammer des Römischen Reichs an massiven Wassermangel. Man sieht es an kleinen Dingen wie den winzigen Früchten, die die Feldpflanzen abwerfen oder am Wassernotstand am Hahn wenn Qualität und Quantität nicht mehr gewährleistet sind. Die Talsperren und Wasserreservoirs leeren sich von Jahr zu Jahr und der Grundwasserspiegel sinkt auf ein bedenkliches Niveau. Währenddessen fällt dem aktuellen Präsidenten des Landes keine sinnvollere und sachdienlichere Methode ein, die Probleme seiner Landsleute zu beheben, als gegen die ins Land geflüchteten Schwarzafrikaner zu hetzen.
Empfehlenswerte Orte
- Ob Tunis, Sousse, Sfax, Monastir, Kairouan oder Mahdia – in jeder dieser Städte lustwandelten wir mit offenen Mündern durch die jeweilige Medina, worunter im weitesten Sinne die Altstadt bzw. das centro storico zu verstehen ist. So man eintritt in dieses Gewirr aus verwinkelten Gassen, steilen Treppchen und bunten Türen, begibt man sich in eine Welt, die derart andersartig, vielfältig und chaotisch ist, dass die Sinne an ihre Grenzen mit Aufnahme und Verarbeitung gelangen. Es ist nicht allein der ständig aktive Basarmodus in dem man sich anfangs befindet (später realisiert man, dass es in jeder Medina überraschend viele Straßen gibt, in denen nichts verkauft wird), es ist kurz gesagt die Vielfalt des Fremden in jeglichen Bereichen. Symbole, Geschäfte, Alltagsgegenstände- und Konstruktionen, Gerüche – es ist soviel neues, was es in seiner geballten Konzentration mit nichts in Europa aufnehmen kann. Wir waren fasziniert und immer wieder aufs neue angezogen von diesen urbanen Schaubühnen. Dabei war natürlich jede Medina für sich etwas ganz eigenes: die schiere Größe der Tuniser Medina erschlug uns förmlich und ließ uns, auch weil es unsere erste war, kapitulierend abwinken und erst mit drei zusätzlichen Tagen konnten wir uns langsam neuen Themen zuwenden. Dann kam die Medina von Sousse, in deren Mauern wir uns für eine gute Woche einquartierten. Deutlich kleiner und überschaubarer hat sie dennoch den unübertreffbaren Reiz, nah am Meer zu liegen, außerdem konnte man hier sogar einen kleinen Teil auf der Stadtmauer promenieren. Die Medina von Monastir war die erste, die uns, zu diesem Zeitpunkt schon abgebrühte Medinabesichtiger nicht sonderlich berührte. Dafür tänzelte ich natürlich voll ungezügelter Aufgeregtheit in das vorgelagerte Ribat. Hier fand eine der komischsten Szenen der Kinogeschichte statt und ich konnte nicht anders als mich in diese Rolle hineinzuleben. Nach Monastir fuhren wir nach Kairouan und damit in die, in unseren Augen bezauberndste Medina, die wir das Vergnügen hatten, erleben zu dürfen. Angenehme Größe, wunderschöne und saubere Straßenzüge, ein annehmbares Verhältnis von Basar und Ruhe, ein gerüttelt Maß an bestaunenswerten historischen Gebäuden und, natürlich, das Epizentrum von Makroud, ein Gebäck, dass ich hier lieben lernte und zu dem wir später noch kommen werden. Die Medina von Mahdia ließ dann nochmals eine ganz andere Qualität blicken. Für diese Altstadt trifft wohl das zu was man mit dem etwas ausgeleierten Begriff ‚authentisch‘ zu beschreiben versucht. Kaum touristische Anker, ein paar kleine Geschäfte ansonsten ausschließlich Wohnungen. Unscheinbar und unauffällig, aber vielleicht am ehesten eine Medina in der man länger leben möchte. Zum Schluss entdeckten wir dann noch die Medina von Sfax. Sfax, eine Stadt, die zuvor viele Tunesier einschließlich einiger Sfaxer als eher schmuckloses Handelszentrum, die nicht viel Sehenswertes zu bieten hätte, titulierten, gefiel uns überraschend gut. Es war eine der wenigen tunesischen Städte, deren Stadtbild außerhalb der Medina so etwas wie ein Stadtzentrum hatte, in dem man als Fußgänger mehr machen konnte als einkaufen und Autos ausweichen. Es gab hier einen relevanten, der Öffentlichkeit gewidmeten Bereich, in dem man sich hinsetzen konnte. Auch der Hafenbereich lud zum Spaziergang ein. Die Medina war in meinen Augen eine perfekte Zusammenfassung aller bisher gesehenen. Herausragend war die imposant wirkende Stadtmauer, inklusive dem ins Stadttor eingepflanzten Café von dem man all den Trubel bestens genießen konnte.
- El Djem hatte keine Medina, dafür aber eines der beeindruckensten antiken Gebäude, welches ich jemals sah. Das Kollosseum, welches sich majestätisch im Zentrum der Stadt über die Niederungen der Gegenwart erhebt, lässt jeden empfindsamen Betrachter erschauern. Einordnungen wie, dass man sich hier vor dem größten komplett erhaltenen römischen Gebäude Nordafrikas und dem drittgrößten weltweit befindet, erscheinen eher nachrangig interessant wenn man sich diesem außergewöhnlichen Ensemble nähert. Wie aus der Zeit gefallen steht es dort als wäre es das normalste der Welt. Wir genossen das Privileg Ende Februar völlig allein hier zu sein und ich hatte dabei dieses kostbare, seltene Gefühl mich so nah wie möglich in eine längst vergangene Epoche zurückdenken zu können. Neben dieser spektakulären Einzigartigkeit hat El Djem aber tatsächlich noch mehr zu bieten. Ein paar Meter abseits findet sich im Archäologischen Museum neben zahlreichen, gut erhaltenen Mosaiken (für diese Fertigkeit waren zu Zeiten des Römischen Reichs die Menschen aus der Provinz Afrika bekannt) eine liebevolle Restauration eines römischen Landguts in fast allen Details (natürlich erneut ein Superlativ, denn es handelte sich um die größte römische Villa auf afrikanischen Boden). Und damit kommen wir noch zu einer tollen Sache, die mir in Tunesien auffiel: Hier traut man sich, an antiken Ausgrabungsstätten, das Vorgefundene zu restaurieren um dem interessierten Besucher ein etwas plastischeres Bild von der Vergangenheit zu bieten als die mit der Zeit austauschbar wirkenden Ruinen Italiens oder Griechenlands. Man möge mir diese Blasphemie verzeihen, aber ich habe nie verstanden warum man die Akropolis nicht wieder rekonstruiert und mit schreiend bunten Farben bemalt.













- Natürlich stand die Wüste im Mittelpunkt unseres Interesses als wir nach kurzen Grenzstreitigkeiten Mitte Januar erstmals afrikanischen Boden betraten. Unsere Prioritäten waren klar: Mittelmeerstrände und Küstennatur würden wir noch genug haben, aber die Chance auf eine richtige Wüste könnte einmalig sein. So entschieden wir uns Anfang März für den Zug von Sfax nach Metaloui und wurden somit zu den wahrscheinlich ersten Touristen, die länger als drei Wochen in Tunesien blieben ohne einen Fuß auf Djerba zu setzen. Wir sollten es nicht bereuen. Allein die Zugfahrt gehörte zu den großartigsten Reiseerlebnissen meinerseits, doch mit dem Ausstieg in der staubigen Bergarbeiterstadt änderte sich die Reise von Grund auf. Wir gaben unsere Anonymität komplett auf und erhielten dafür die Freiheit wieder ohne allzuviele Belästigungen durch die Zivilisation in die Pedalen zu treten. Soll heißen: Mit Eintritt in dieses Gebiet war irgendwer von den „Organen“ stets informiert wo wir waren und wo wir morgen hinwollten, aber bei diesem „fürsorgenden Interesse“ beließ man es. Dafür erhielten wir nahezu verkehrsfreie Straßen mit Blick auf eine nie gesehene Leere des Horizonts. Übernachtungen waren in den jeweiligen Oasen entweder auf teils vorzüglichen Campingplätzen oder in Jugendherbergen (Link im Anhang) problemlos möglich. Selbst dieser ausführlichste aller Berichte ist nicht ausführlich genug um auf all die schönen und außergewöhnliche Orte, die wir in diesen Wochen besuchten, einzugehen. Daher hier nur eine kurze Auflistung: Chebika, Tamerza, Mides, Tozeur, Nefta, Degache, Kebili, Douz und Qasr Ghilan. Keinen dieser Orte mag ich in meinen Erinnerungen vermissen. Alle hatten sie etwas ganz spezielles an sich, wie das Radeln durch dieses lebensfeindliche Nichts sowieso etwas ganz besonderes war, so übte das Erreichen einer Oase stets aufs neue eine irrlichternde, vitalisierende Faszination aus, die ich meinen Lebtag nicht vergessen werde.















Empfehlenswerte Speisen & Getränke
Auch wenn die eingangs erwähnte Realität minderer oder mangelhafter Qualität von Lebensmitteln nicht unbedingt darauf schließen lässt, dass in Tunesien die Geschmacksknospen übermäßig gereizt werden, so kann ich nur mit aller Kraft behaupten: Werden sie doch! Und zwar im allerbesten Sinne. Ich spreche hier einerseits über die allerorten vorhandene Kultur kleiner Imbisse und Garküchen sowie die Meisterklasse aller Länder Küchen: Zuhause bei anderer Leute Mama. Apropos, ein wichtiges kleines Detail fiel mir beim gemeinsamen Essen sofort auf, speziell nach fast vier Monaten Italien: In Tunesien trinkt man nicht während man isst. Wie man auch generell sehr wenig und wenn dann sehr bewusst trinkt. Für mich eindeutig ein kultureller Wink mit dem Wüstenpfahl und eine etwas unbequeme Angewohnheit da ich einen Schluck Wasser zum Essen schon sehr schätze.


- Lablabi – vielleicht unsere erste große Entdeckung. Einfach, billig und dennoch ein schmackhaftes, sättigendes und vor allem wärmendes Fest für den ausgekühlten Organismus. Diese Suppe findet man in den Wintermonaten wohl in jeder nennenswerten Ansiedlung. Sie besteht im Wesentlichen aus einer würzigen Fleischbrühe, Brot, Kichererbsen, einem Ei und natürlich Harissa. Das Ritual startet damit, dass man ein halbes Baguette und eine Schüssel in die Hand gedrückt bekommt, mit der Aufforderung, das Brot in möglichst kleine Teile zu zerpflücken und in die Schüssel zu tun. Hiernach wird ein kräftiger Schwall Brühe und die restlichen Zutaten hineinbefördert um sodann vom hungrigen Konsumenten ordentlich durchmengt zu werden. Eine solide Mahlzeit auf die wir immer wieder gerne zurückkamen, auch wenn wir mit der Zeit auf das Brot verzichteten und stattdessen mehr Kichererbsen forderten.
- Couscous – natürlich, denn womit verbindet man Tunesien neben Harissa wohl am häufigsten? Mit Couscous. Tatsächlich kamen wir recht spät damit in Berührung, denn in den von uns anfangs frequentierten Lokalen konnten wir es nicht finden. So genossen wir unser erstes Couscous von einem Gastgeber, der es zum ersten Mal alleine zubereitete (Mutter und Frau waren ausgeflogen) und es war vorzüglich. Danach gab es dann noch etliche Male dieses populäre Gericht mit den verschiedensten Gewürzen und Beilagen. Doch das erste Mal war es irgendwie doch am schönsten.
- Brik, Fricasee, Kaskrout – die heilige Dreifaltigkeit unserer Alltagsnahrung so wir uns in Städten aufhielten und das taten wir in Tunesien fast immer. Ich denke, nur die ersten beiden gehören kurz erklärt. Fricasee sind winzige, frittierte Brötchen mit einer wechselnden Füllung. Zumeist aber ein Ei, Thunfisch und, natürlich, Harissa. Unter Briks versteht man im wesentlichen das gleiche Prinzip. Nur dass man hier den Inhalt komplett im Teig verschließt und dann toastet. Frisch ein absoluter Hochgenuss! Bei Kaskrout handelt es sich eigentlich nur um eine Art Sandwich, belegt mit allem möglichen, meist aber Thunfisch, Wurst oder auch Schawarma. Ein unkomplizierter und häufiger Straßensnack
- Muluchia – kommen wir nun zu meinem persönlichen Favoriten der tunesischen Küche, bzw. wie mir versichert wurde, eigentlich der gesamten arabischen Küche. Man nehme ein Stück Lamm und lass es 24 Stunden köcheln in einem Brei der mit einem Pulver aus der zerriebenen, gleichnamigen Pflanze gewonnen wird. Das auf der Zunge zergehende Fleisch, wie sich dessen Aromen mit dem kräuterig-herben Geschmack der Soße ein verspieltes Stelldichein gönnen – wo auch immer ihr seid, solltet ihr dieses Gericht sehen, schlagt zu. Unbedingt! Die botanische Hintergrundgeschichte hat es ebenso in sich: Die Langkapselige Jute (Corchorus olitorius), welche im Deutschen neben Muskraut angeblich auch unter dem schillernden Namen Gemüsejudenpappel bekannt sein soll, kommt aus Indien/ Pakistan und wächst aktuell in pantropischen Regionen. Mir war sie zuvor gänzlich unbekannt. Ich liebe es, solcherlei Dinge, die in anderen Weltengegenden völlig gewöhnlich sind, kennenzulernen und mit Wonne in den eigenen Gebrauch einzugliedern.

- Bsissa – kommen wir nun zu den süßen Entdeckungen, wobei Bsissa hier nur bedingt ins Raster passt, bzw. nur dank der Beimischung von gewaltigen Portionen Halwa den Ruf einer Süßspeise errungen hat. Es handelt sich hierbei um eine Getreide- und Pflanzenmehlmischung die entweder mit Olivenöl (kalt) oder Wasser (warm) angerichtet wird und angesichts dieser Zutaten natürlich eine enorm sättigende Wirkung erzielt. Ich gestehe offen, dass es sich hierbei nicht um den wohlschmeckendsten Leckerbissen handelt, aber die Einfachheit, Kompaktheit und nicht zuletzt der günstige Preis ließ mich in Zukunft immer eine Tupperdose mit fertig angerührten Bsissa dabeihaben und für die Rückkehr nach Europa deckte ich mich gehörig mit den verschiedenen Sorten an Bsissa ein.



- Makroud – ach, voller Sehnsucht denke ich hier im Lande der Canollis und Cantuccinis an diese kleinen Gaumenfreuden. Diese Spezialität der Stadt Kairouan (ja, genau dieses Kairouan mit der schönsten Medina, siehe oben), ist ein Gebäck, das aus einem Teig aus Hartweizengries hergestellt und mit Datteln (manchmal auch Mandeln) gefüllt wird. Der Teig wird in Rautenform geschnitten, in Öl frittiert und in Honigsirup getaucht. Wir lernten sie bei Slim in den Arbeitspausen kennen und bald waren sie aus unserem kulinarischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Frisch aus der Bäckerei am späten Vormittag oder auch nachmittags zum Tee. Hach, ich glaube, das war was Ernstes mit mir und Makroud.

- Halwa – bei Halwa hörte meine dem Süßen neuerdings sehr toleranten Regungen auf. Dies war für mich einfach nur klebrige Zuckermasse, egal was man an köstlichen Nüssen auch hineintat. Ich muss es hier nur pflichtschuldigst erwähnen, da es einerseits so etwas wie der ebenso allgegenwärtige Antagonist zu Harissa war, und andererseits ein Teil der Reisegemeinschaft eine teilweise bedenkliche Abhängigkeit zu diesem Stoff entwickelte.
- Chobs m´lawi – es gibt verschiedene Brotvarianten in diesem, den Weizen über alles verehrenden Land. Eine der köstlichsten Varianten kam uns dabei irgendwie bekannt vor. Tatsächlich hatten wir diese entzückend simple Backvariante oft in Georgien gesehen. Freudig wiedererkennend griffen wir zu und erzählten den wie immer freundlich lächelnden Tunesiern von einem fernen Volk in den Bergen, welches sein Brot in ganz ähnlicher Weise produzierte. Höfliche Skepsis schlug uns entgegen, natürlich, das sei ja auch eine sehr sinnvolle Art des Brotbackens. Mag sein, dass sich das auch andere abgeschaut hätten. Aber soweit im Osten, nunja, wenn ihr das wirklich gesehen geglaubt habt…



- Tee – ich wusste wenig als ich mich nach einem knappen Vierteljahr Italien einem Schiff anvertraute, welches mich in ein mir unbekanntes Land bringen sollte. Aber bei einer Sache war ich mir gewiss: Es wird Tee geben und von Kaffee sollten sie auch was verstehen. Denn von zwei Sachen versteht man in dem Lande von Genuss und lukullischer Perfektion leider nichts: Gutem Tee und Hochprozentiges mit Charakter. Bei letzterem hatte ich verständlicherweise keinerlei Hoffnungen, doch hinsichtlich Tee wurden meine Hoffnungen nicht enttäuscht. Zumindest die Galaversion (siehe Bild) wahlweise mit Pinienkernen oder Mandeln ließen mich verzückt mit den Geschmacksknospen klimpern. Interessant hierbei übrigens, dass wir weder im Tee-Kontinuum oder im Caj-Universum angekommen waren. Man nannte es hier preisverdächtig kompromisslerisch Taj. Der Lybier sagt Caj, der Algerier Thé. Dabei stieg ich im Laufe des Aufenthalts immer häufiger auf Kaffee um, da dies das mit Abstand unsüßeste Getränk war, welches man in Bars erwerben konnte. Denn, obwohl wir stets als erstes und mit ernsten Mienen um Tee ohne Zucker baten, bekamen wir in lässiger Zuverlässigkeit ein Getränk serviert, dass sich offensichtlich zuvor mit einer Zuckerdose gepaart hatte. Voller Neugierde bestellte ich an meinem letzten Abend mal einen Tee mit Extra Zucker – nach dieser Narretei begriff ich erneut, dass man sein Schicksal nicht grundlos herausfordern sollte.


Exkurs: Ramadan
Ich bin alles andere als ein Freund von Religion und ein leidenschaftlicher Verächter von Ernährungsvorschriften jedweder Coleur. Es verwundert also eher mittel, dass ich dem Ramadan mehr als skeptisch gegenüber stand. Dennoch war ich als allzeit neugieriger Reisender gespannt darauf wie sich ein Land in dieser Phase verändern würde und versuchte anfangs sogar vorsichtig mitzufasten um ein Gefühl für die sich verändernde Situation zu bekommen. Doch schon in den ersten Tagen verlor ich die Geduld mit dieser landesweiten Pseudo-Askese, welche im Gewand einer Empfehlung daherkam, in Wirklichkeit aber eine gruppendynamisch-dogmatische Zwangsjacke war. In der Realität änderte sich dabei auf den ersten Blick recht wenig. Die gesamte Gastronomie hatte geschlossen und das war’s. Alle arbeiteten fleißig weiter, sogar etwas emsiger als zuvor wie uns schien. Wer weiß, vielleicht weil konzentrierte Beschäftigung auch gut vom Hungergefühl ablenken kann. Auf den zweiten Blick bemerkte ich die Ungeduld und Gereiztheit im Straßenverkehr sowie die herrliche Viertelstunde Totenstille auf den Straßen wenn sich der Sonnenuntergang näherte. Ich habe mir all das mehrere Tage geduldig angeschaut und abgewägt und konnte an der Idee eines Jojo-Fastens (wenn man allein die Berge an Zucker bedenkt, die sich im Dunklen reingeschoben werden) und vor allem die heikle Angelegenheit des Dehydrierens nichts Gutes finden. Kurz brachte mich der Bruder eines hier kennengelernten Freunds ins Nachdenken. Er meinte, dass für ihn und viele andere der Ramadan nicht aus religiösen oder gar gesundheitlichen Motiven heraus betrieben würde. In seinen Augen wäre dies ein Monat in dem man sich auf eine Ebene mit den Ärmsten der Gesellschaft begeben würde um sich mit ihnen zu solidarisieren und zu sehen ob man Hunger und Durst wie sie das ganze Jahr zu erleiden hätten, noch ertragen könne. Dabei legte er sich bedächtig eine Dattel in den Mund und kaute genüsslich darauf herum, sah mir mit ruhigen Blick in die Augen und auf beiden Seiten des Tisches breitete sich ein unüberwindbares Gefühl von Rechtschaffenheit aus. Es sind diese Momente in denen ich Reisen verabscheue, es sind diese Erfahrungen weshalb wir alle reisen sollten.
Exkurs: Alkohol
Da ich in meinen ersten Tagen erfolglos nach einer kurzen Anleitung suchte wie man in meinem neuen Zuhause an Bier und Wein kommt, möchte ich es hier kurz veröffentlichen. Abgesehen von Restaurants und Bars in größeren Städten ist der gängigste Weg mit dem Besuch eines MG (Magasin General) oder Carrefour verbunden. Diese, meist sehr leer wirkenden Supermärkte haben im hinteren Bereich einen räumlich abgetrennten Bereich, in dem es Alkohol gibt. Man findet sie eigentlich am einfachsten in dem man dem Strom von gezielt in eine Richtung schlendernden Männern folgt. Wenn diese riesigen Supermärkte häufig durch leere Gänge und lieblos mit wenigen Produkten gefüllten Regalen auffallen, so haben sie offensichtlich den einzigen Daseinszweck, die Bevölkerung mit Alkohol zu versorgen. Denn hier, in dem gut versteckten, winzigen Raum kommt Einkaufsstimmung auf. Hier stehen sich die Menschen in den Hacken, vergleichen Preise, wägen ab, um dann in aller Selbstverständlichkeit durch die leeren Gänge zur Kasse zurückzutrotten und zu bezahlen. Also: MG oder Carrefour, der Raum löst sich jedoch jeden Freitag und am Ramadan in nichts auf. Und kauft besser Wein als Bier. Vertraut mir einfach.

Empfehlenswerte Unterkünfte
Natürlich gelten hierzulande andere Regeln und Selbstverständlichkeiten hinsichtlich des freien Übernachtens. Wir tasteten uns ganz langsam und ohne Hast an diese heran. Schließlich begrüßte uns Afrika zunächst mit frischen Temperaturen, eisigen Wind und jeder Menge Regen. Somit blieben unsere Übernachtungsmöglichkeiten zu Beginn auf billige Hotels und freundliche Gastgeber beschränkt. Erst nach einigen Wochen trauten wir uns endlich auf die Straße und zelteten erstmals wild am Strand. Hier so wurde uns von allen Tunesiern versichert, sei so relativ alles erlaubt. Jeder würde hier ohne Probleme grillen, Party machen oder eben ein Zelt über die Nacht aufschlagen. Wir können dies definitiv bestätigen. Zumindest außerhalb der Saison und Städte ist dies zweifellos möglich und wie an jedem Meer der Welt ein Hochgenuss. Abseits der Strände gestaltet sich das Wildzelten schon schwieriger. Die Realität sieht hier wie beschrieben größtenteils sehr vermüllt und zugebaut aus. Außerhalb der Städte fährt man durch riesige Olivenplantagen oder wenig einladende, von allen Seiten einsehbare Halden und Schuttlandschaften. So muss man hier zumeist auf eine Unterkunft über booking zurückgreifen so nicht der Zufall aushilft und man für eine Nacht eingeladen wird.
Im Süden findet man eine grundlegend andere Situation vor. Die Städte sind hier kleiner, die Bevölkerungsdichte dünner. Hier fällt man als Radreisender natürlich noch sehr viel mehr auf und die Kontrolle nimmt zu. In Metaloui angekommen, wurden wir von der Polizei in Empfang genommen und zur hiesigen Jugendherberge eskortiert (Das PDF zu den tunesischen Jugendherbergen hat uns stets gute Dienste geleistet, Doppelzimmer zwischen 20-30 Dinar, es findet sich im Anhang zum runterladen). In dieser, für uns fremden Region verzichteten wir freiwillig aufs wildzelten und vertrauten uns Campingplätzen und Jugendherbergen an, denn eins von beiden gab es immer in jeder Oase. Stets wurden wir diskret gefragt wohin wir unterwegs seien und registrierten, dass diese Information kurz darauf relativ sorglos an die „zuständigen Organe“ weitergegeben wurde. Doch ich kam klar mit dieser Form der sanften Überwachung, spendete sie doch auch gewissermaßen etwas Sicherheit in diesem ungewohnten Terrain. Auf die besten Plätze möchte ich nun kurz eingehen
- El Berima – etwas außer der Reihe will ich hier für Slim und sein Projekt El Berima die Werbetrommel rühren. Hierbei handelt es sich selbstverständlich nicht um einen Campingplatz oder eine reizvolle Gratis-Übernachtungsgelegenheit. Slim versucht hier, wenige Kilometer vom Moloch Tunis entfernt, auf seinem Grundstück ein kleines Stück Utopie zu realisieren. Permakultur und gesunde Landwirtschaft. Ein notwendiger Schritt und hoffentlich bald nicht mehr mit dieser exzentrischen Insellage. Wer also hier vorbeischneit, sollte Energie mitbringen um dieses Projekt zu unterstützen. Man wird dafür mit Makroud und jder Menge anderer erfreulicher Dinge überschüttet.
- Das Restaurant Cascade in Tamerza ist weit mehr als ein Restaurant. Es befindet sich direkt über dem Wasserfall mitten in unserer ersten Oasenstadt. Wir fanden hier einen sich überschlagenden hilfsbereiten einsamen Concierge/Koch/Kellner/Stadtfüher/Hotellier, der uns einen Platz für unser Zelt offerierte, was so relativ alles bisher Dagewesene überbot. Auch das Essen war vorzüglich. Eine absolute Empfehlung für jeden der hier vorbeikommen sollte.
- Unser absoluter Lieblingsplatz befand sich jedoch in Degache. Der Camping Badi befindet sich kurz vor dem großen Salzsee und ist einfach nur perfekt. Als überzeugte Wildzelter wissen wir um die Notwendigkeit von Campingplätzen. In gewissen Abständen benötigen wir von ihnen eine Dusche, Waschmaschine, Strom, WLAN und Gesellschaft (in genau dieser Reihenfolge). Das alles schön und unaufgeregt angeordnet ohne viel Tamtam und Zusatzkosten. Was soll ich sagen?! Dieser Campingplatz erfüllte all unsere Bedingungen – ein nahezu perfekter Campingplatz. Wenn ich zudem an den Preis von €6 pro Nacht denke, muss ich hier in Sardinien kurz eine kleine Träne wegdrücken.
- Und zum Abschluss noch ein kleiner Aussenseitertipp. Das winzige Küstenstädtchen Zarat auf halben Weg zwischen Gabes und Djerba hatte vor 2-3 Jahren noch einen kleinen, aber feinen Zeltplatz direkt am Strand, welcher von der Stadt vielleicht einen knappen Kilometer entfernt ist. Doch dann veralgte der Strand und Covid gab der kleinen Anlage dann den Rest. Nun kann man hier die komplette Infrastruktur eines Campingplatzes nutzen (Wasser und Toiletten sind leider abgestellt). Hier kann man ungestört eine ruhige Nacht am Strand verbringen. Nur den morgenlichen Sprung in die Wellen sollte man hier eher bleiben lassen.




Nützliche Links
- Die staatliche Eisenbahn Tunesiens (SNCFT) im Kurzporträt
- sowie der Link zur Verbindungsinformation
- wwoofing Tunisia
Radstatus
Die Erfahrungen anderer Radreisender mit dem dornigen Tunesien ließen uns aufmerken und extra ein paar neue Reifen plus Ersatzreifen in Deutschland bestellen. Tatsächlich hielt sich der Kummer dann glücklicherweise in Grenzen. Bereits am ersten Wüstentag hatte Radosława II. einen Platten und erhöhte in der Gesamtwertung damit auf 5 gegenüber einem Platten meiner Diva. Ansonsten hielten sich die Probleme in Grenzen, es sei aber dennoch gewarnt, das wer sich mit dem Rad nach Tunesien wagt, alles an relevanten Ersatzteilen dabei haben sollte, denn hier wird er so schnell nicht fündig werden. Erst in Italien bemerkten wir leichte Unregelmäßigkeiten an der Nabe von Radosława II. Die Pedalen drehten sich im Leerlauf mit, ein leichtes Ticken war zu hören und der elfte Gang ging erst nach langem Drehen rein. Daher suchen wir nun nach einem Fahrradmechaniker, der sich in der Lage sieht, beide Naben zu öffnen, zu säubern und nachzufetten. Nach über 7000km ist eine solche Generalinspektion durchaus üblich. Nur ist ein Mechaniker, der mit solch einem neumodischen Ding vertraut wäre, hier auf der Insel der Grünseeligen nicht so leicht aufzutreiben. Unsere Hoffnungen wenden sich also gen Korsika, bzw. den Städten des norditalienischen Festlands zu. Und wenn nicht, ja dann müssen wir wohl selber ran. Was empfehlenswert wäre, da wir in Zukunft wohl immer weniger Experten treffen werden, die sich mit so etwas auskennen und es unabhängiger macht und natürlich auch das Budget schont.

Was sich verändert hat (nach 287 Tagen)
Lang, sehr lang habe ich diesbezüglich keine Wasserstandsmeldung mehr abgegeben und dementsprechend drastisch mag das bestimmende Grundgefühl erscheinen. Das wechselhafte Leben zwischen Zelt, Hotel und Einladungen, vom unentwegten Unterwegssein ist die Normalität geworden, und die Version eines sesshaften Lebens erscheint fern und absurd. Es entbehrt dies natürlich nicht einer gewissen Ironie, da stets, vor großen wie kleineren Reisen sich die Sorge einnistet, ob man zu derlei Reisen noch in der Lage sei. Ob es erneut möglich sein wird, das unablässige Suchen nach einem schönen Plätzchen zum Schlafen und das ununterbrochene Unstete in der Fremde. Vor jeder Reise nagt dieser Zweifel an einem, bevor man aus dem Geborgenen der festen Wohnung, der gewohnten Umgebung aufbricht und die Gewissheit eines eigenen Betts und gesicherter Privatsphäre für längerer Zeit aufgibt. Nun, diese Sorgen liegen lang zurück. Wir haben Jahreszeiten, Länder, Berge, Täler und Feiertage durchlebt. Wir haben Luxus genossen sowie Not erfahren, doch letztlich fanden wir für jedes eine Lösung und jeden Abend ein Plätzchen zum schlafen. Die bürgerlichen Ansprüche auf Besitz und Grenzen sanken, während die Lust an der dadurch gewonnenen Freiheit zunahm.
Dabei lassen wir es gegenwärtig etwas langsamer angehen. Die idyllischen, und noch von der Saison verschonten Gestade Sardiniens laden zum Dasein ein und bremsen uns mit aller gebotenen Sanftmut aus. Es ist dies tatsächlich eine so unglaublich schwer zu erlernende Sache auf Langzeitreisen. Denn so merkwürdig es klingt, kann die tägliche Luxuslast der Entscheidung des ‚Wohins‘ den Blick darauf verstellen, dass man eventuell auch angekommen sein könnte. Zumindest für den Moment. Die Kunst des Innehaltens, des freien Sinnierens im Jetzt und Hier, das will gekonnt sein. So weitet sich das Prisma der Möglichkeiten um einen weiteren Faktor: Die Entscheidung, erstmal nichts zu entscheiden. Wir werden von Tag zu Tag besser in dieser Königsdisziplin langer Reisen und danken Sardinien für seine, dieses Bestreben in jeder Hinsicht unterstützenden Art. Schließlich nähern wir uns in wenigen Wochen (nach Korsika) der wohl schwersten Entscheidung dieser Reise: der Sonne entgegen oder mit ihr ins Abendrot radeln – das ist hier die Frage.
Entdecke mehr von Viva Peripheria
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
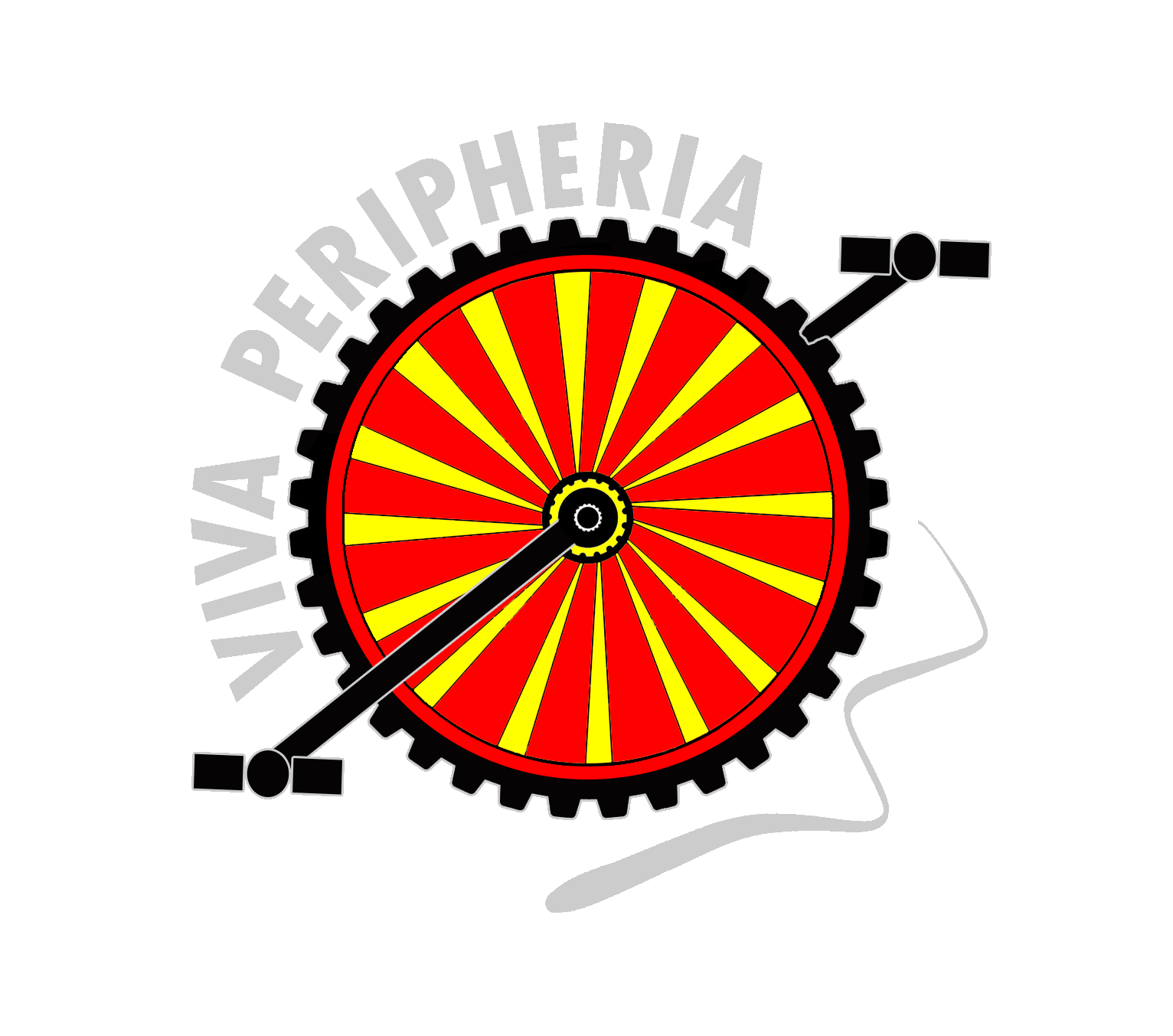
































Gut zu wissen, dass es überall auf der Welt deutsche Botschaften und Konsulate gibt, wo man sich von zu viel Gastfreundschaft, Unkompliziertheit und Menschlichkeit erholen kann.
Wie war es denn eigentlich in dem „Deutsch Café“?
Ja, wenn sie für irgendwas da sind dann doch um anständig geerdet zu werden.
Das“Deutsch Café“ hatte leider noch nicht geöffnet. War ja noch keine „Deutsch Saison“.
Zu den wiederaufgebauten Römerruinen:
In Caesarea in Israel haben die eine ganz gute Lösung gefunden. Die alten Stätten werden weitgehend wiederaufgebaut, am besten mit den vor Ort gefundenen Steinen. Aber eine dicke schwarze Linie markiert den Bereich, wie er original ausgegraben wurde, von den aufgesetzten Steinen.
So sieht man mehr, aber die Archäologiepuristen werden nicht ge- und enttäuscht. (Obwohl die wahrscheinlich immer etwas zum Meckern und Mosern finden.)
Danke für den ausführlichen Bericht mit allen Sonnen- und Schattenseiten und für die wirklich fantastischen Fotos! Diese Farben, dieses Licht, wow!
Und viel Vergnügen in Sardinien!