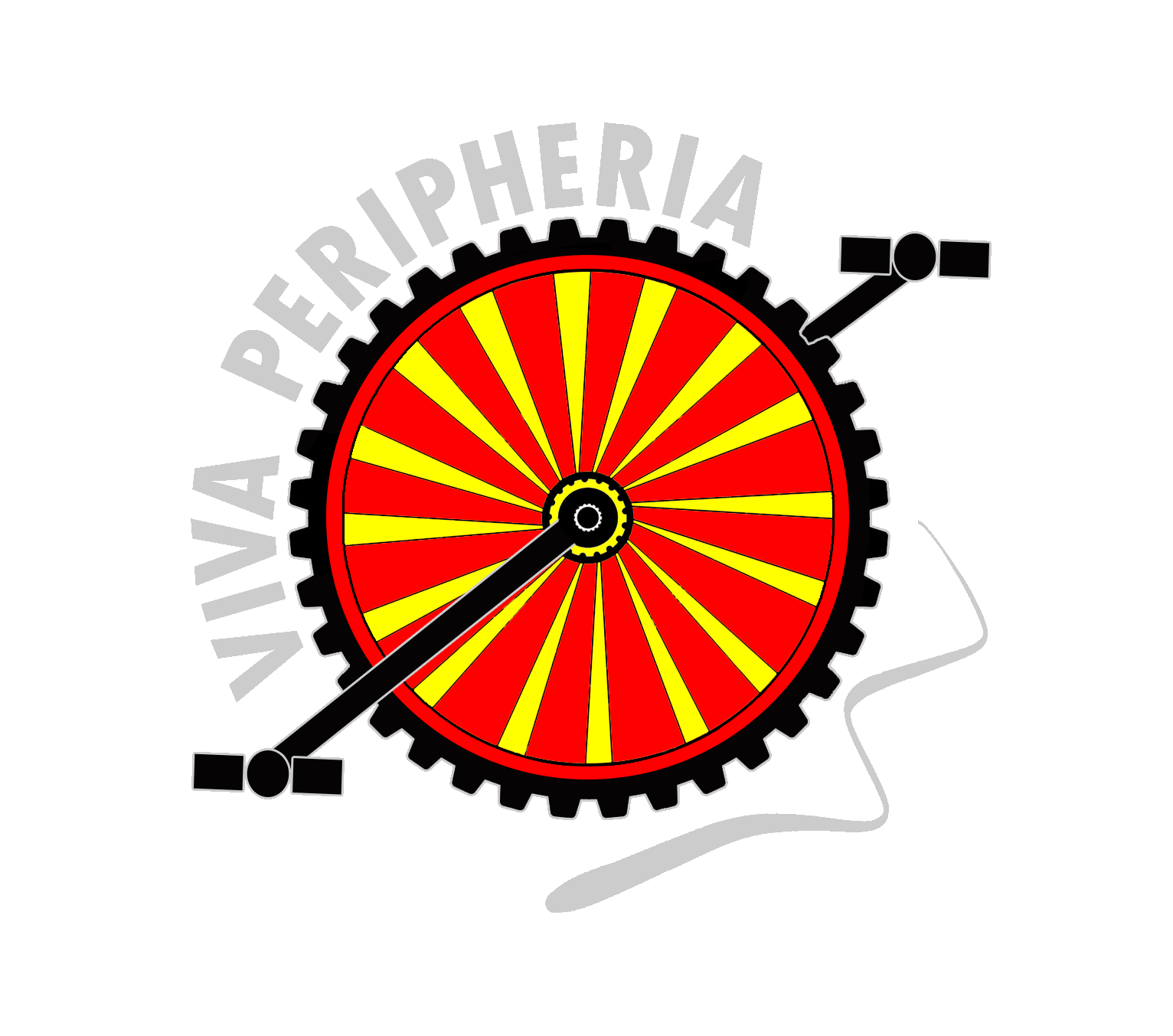- Warum es wieder losgeht oder eine neuerliche Hamsterradkritik
- Von Friedrichshain über Friedrichshain hin zu böhmischen Dörfern
- Von tschechoslowakischen Höhen und Tiefen
- Diashow, die erste: Von Heidesee bis fast zum Triglav
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (1) von Altungarisch bis Walachei
- Über idyllische Plattitüden und endloses Grün
- Über das januszipfelige Istrien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (2) von Adige bis Theodor Mommsen
- Reisen nach Zahlen – 100 Tage
- Von einer die auszog das Fürchten zu verlernen
- Der italienischen Reise erster Teil
- Die besten Gerichte von draussen
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (3) von Basilikata bis Wildschwein
- Der italienischen Reise zweiter Teil
- Der italienische Reise dritter Teil
- Einblicke ins Reisetagebuch
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (4) – Von Ätna bis Zitrusfrüchte
- Reisen nach Zahlen – Tag 200
- Währenddessen in Afrika
- Così fan i tunisini
- Eisenbahnfahren in Tunesien
- Von Menschenhaufen und anderen Platzhengsten
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (5) von Agave bis Tuareg
- Tunesien – auf der Suche nach der Pointe
- Reisen nach Zahlen – Tag 300
- Sardinien – der italienischen Reise letzter Teil?
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (6) von Asinara bis Tafone
- Kleine, feine Unterschiede
- Im Autokorsika über die Insel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (7) von Elba bis Tarasque
- Fahrradfahren (u.v.m.) wie Gott in Frankreich – erste Eindrücke
- Jahrein, jahraus, jahrum
- Ausrüstung für Langzeitreisende – ein paar grundlegende Gedanken
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (8) von Baselstab bis Wasserscheidenkanal
- Reisen nach Zahlen – Tag 400
- Querfeldein und mittendurch – Frankreich vom Rhein bis zum Atlantik
- Wissensstrandkörner aus dem Reisewatt – Gezeiten-Sonderausgabe
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 (Frankreich)
- Projekt-Radria-Gleiche (Tag 426)
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (9) von El Cid bis Wanderdüne
- Der Jakobsweg – ein fader Pfad im Kurzporträt
- Ratgeber: Fahrradfahren auf dem Eurovelo 1 (Velodyssée)
- Unter Jakoblingen – von den Pyrenäen bis ans Ende der Welt
- Wissensplitter aus dem Reisesteinbruch (10) von Don Sueros de Quiñones bis Saudade
- Reisen nach Zahlen – 500 Tage
- Kopfüber durch Portugal und zurück
- Aus dem Reiseplanungslabor: Arbeitskreis Westafrika
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (11) von Azulejos bis Wasserballastbahn
- Meerdeutigkeit
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (12) Von Al-Andalus bis zu den Säulen des Herakles
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (13) von Alcazaba bis zur Unbefleckten Empfängnis
- Andalusien – ein Wintermärchen
- Reisen nach Zahlen – 600 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (14) von Flysch bis Trocadéro
- Rowerem przez peryferie
- Von Aisha Qandisha bis Moulay Idriss (15) Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch
- Jauchzend betrübt – die Packungsbeilage für Marokko
- Marokkohochjauchzende Menüvorschläge
- Reisen nach Zahlen – 700 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (16) von Corniche bis zur Via Domitia
- Die „Reiß-dich-am-Riemen“-Tour oder Radwandern für Durchgeknallte
- Ratgeber: Radfahren auf dem Eurovelo 8 – „La Méditerranée“
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (17) von Bektaschi bis Vučedol
- Giro della Jugoslavia
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 – das Balkankapitel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (18) von Chinesischer Jujube bis Ъъ
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch – MYTHOLOGIESPEZIAL – eine kleine Umschau des Irrsinns
- Was wurde eigentlich aus dem Römischen Reich? Eine ausführliche Inventur der verbliebenen Provinzen
- 852 Tage – Doppelt hält besser
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (19) von Atatürk bis Tigris
- Von Bačka Palanka zum Goldenen Vlies – Endspurt zum Kaukasus
- Z Nysy do Nysy
- Jahresrückblick 2024
- Reisen nach Zahlen – Tag 900
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (20) von Chichilaki bis zum Schutzvertrag von Georgijwesk
- Pflanzen, die es geschafft haben
- EIL: Wie man eine geschlossene Grenze überquert – auf dem Landweg von Georgien nach Aserbaidschan
- Reisen nach Zahlen – 1000 Tage
- Georgien – Winterschlaf im Schatten des Kaukasus
- Kurzanleitung: Mit dem Schiff von Aserbaidschan nach Kasachstan
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (21) von Avtovağzal bis Tamada
- А вы откуда? Mit dem Rad durch Aserbaidschan
- Wissenssplitter aus den Reisesteinbruch (22) von Aralkum bis Zoroastrismus
- Ratgeber: Wandern im Fan-Gebirge (Tadschikistan)
- Seitenstrasse – Seidenstrasse: Mit dem Rad vom Kaukasus nach Zentralasien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (23) von Aalam Ordo bis Yssyk-Köl
- Reisen nach Zahlen – 1100 Tage
- Elf Anekdötchen aus 1111 Reisetagen
- Ratgeber: Mit Rad, Baggage und Eisenbahn durch Zentralasien
- Mein Drei-Tage-China – der Ersteindrucks-Cocktail
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (24) von Apfel bis Yak
- Willkommen in Stania – die Fantastischen Vier Zentralasiens
- Reisen nach Zahlen – Tag 1200
- Die Mongolei – wie alles war, bevor alles begann
- Ratgeber: Südkorea und die besten Radwege der Welt
Die erste Verwirrung kam zumindest in einem spektakulären Gewand – das Kloster von Mont-Saint-Michel ist vielleicht die populärste, französische Attraktion außerhalb von Paris. Natürlich hängt das zweifellos damit zusammen, dass es als „eines der umfangreichsten, schwierigsten und kostspieligsten Bauprojekte des gesamten Mittelalters“ gilt. Aber es liegt eben auch an dem faszinierenden Umstand, dass die Gezeiten hier für eine Teilzeitinsel sorgen. Nun war uns das Prinzip von Ebbe und Flut nicht völlig unbekannt. Auf einigen Reisen zuvor begegneten wir bereits diesen flexiblen Meeresküsten, doch so extrem wie hier hatten wir es noch nie erlebt. Bis zu 13m kann der Höhenunterschied hier zwischen Hoch- und Niedrigwasser betragen. Bei Saint-Malo, welches wir kurz danach besuchten, sogar bis zu 16m. Hier steht folgerichtig dann auch das erste, und für lange Zeit auch das größte Gezeitenkraftwerk der Welt. Seit 1967 speiste dieses Kraftwerk spektakuläre 240 Megawatt ins Stromnetz und war damit über 40 Jahre einsame Spitze. Erst 2011 überboten die Südkoreaner diese Leistung in dem sie ein Kraftwerk präsentierten, welches popelige 14 Megawatt mehr produzierte.

Aber genug der technischen Meisterleistungen. Kommen wir zu der eingangs erwähnten Verwirrung. Als ich in den nächsten Tagen immer wieder erschüttert das Ausmaß der Veränderung bestaunte, welches die Gezeiten hier am Atlantik verursachten, dachte ich so bei mir, wie wohl Menschen früherer Jahrhunderte und Jahrtausende dieses Phänomen interpretiert hatten. Was hatten zum Beispiel die Römer nach erfolgreicher Eroberung Galliens gedacht, als sie, von ihren ruhigen Mittelmeerküsten kommend, vor dieser Naturgewalt standen? Ganz klar, hier musste der Aberglauben und das Überirdische ganze Arbeit geleistet haben um das menschliche Gemüt zu beruhigen. Aber weit gefehlt! Ein kurzer Check bei Tante Wikipedia ließ mich aufmerken, offensichtlich hatte ich die Altvorderen mal wieder massiv unterschätzt.
Dass Ebbe und Flut vorwiegend mit dem Mond korreliert sind, dürfte zu den ersten astrophysikalischen Erkenntnissen des Menschen gehören.
Tante Wikipedia
Die meisten Menschen, denen wir ab sofort unser Leid klagten, dies alles nicht ganz zu verstehen, reagierten überrascht, murmelten abwiegelnd etwas wie, „das hängt mit dem Mond zusammen“, „Gravitation und so“, aber beließen es dabei. Uns befriedigte das leider nur so mittel. Daher haben wir in den letzten Wochen über kaum ein Naturgesetz mehr diskutiert und gegrübelt als eben jene der Gezeitenkräfte. Falls jemand helfen möchte, das was wir bei Wikipedia im Nichtschwimmerbecken unter „Einfache Erklärung“ fanden, haben wir begriffen. Doch hier fangen unsere Probleme leider erst an. Als wir uns nämlich in der üblichen gemächlichen Radfahrergeschwindigkeit fortbewegten, registrierten wir erstaunt, dass sich die Gezeitenzeiten (dämliches Wort im übrigen) zum Teil erheblich unterschieden, was uns zum Fragenkomplex Nummer 1 der untenstehenden Liste führt.

Ein weiteres, großes Fragezeichen steht hinter der Frage der Höhenberechnungen von Flut und Ebbe (Fragenkomplex Nummer 2). Natürlich spielt hier das unterseeische Relief wie auch Strömungen und Winde eine Rolle für den Anstieg des Pegels. Das sind alles sehr variable und umfassende, quasi ausufernde Datensätze. Wie, verdammt nochmal, können sie für dutzende, ja hunderte Messpunkte exakte Pegelstände voraussagen? Fragekomplex 3 gilt mittlerweile dagegen als annähernd gelöst. Tatsächlich sind die Tidenkräfte in Äquatornähe am stärksten, und dass man große Tidenhubs eher mit der Nordhalbkugel verbindet, liegt wohl eher an dem eigenen Eurozentrismus und einem, solchen großen Tidenwellen entgegenkommenden Küstenverlauf als an, der geographischen Breite geschuldeten, möglichen Eigenheiten.

- 1. Wie kommt es zu den unterschiedlichen Zeiten von Flut und Ebbe an nah beieinander liegenden Orten?
- 2. Wie entstehen die unterschiedlichen Höhen von Flut und Ebbe? Und, vor allem, wie kann das berechnet werden?
- 3. Spielt die geographische Breite eine Rolle? Sprich, gibt es Gezeiten am Äquator?
- Zusatzfrage: Wie haben sich die Gezeiten erdhistorisch entwickelt? Sprich: Führten Veränderungen der Mond- und Sonnenlaufbahn hier vor Jahrtausenden zu Veränderungen? Und wie würden Gezeiten auf Planeten mit zwei oder noch mehr Monden aussehen?


Die Zusatzfragen sind dabei eher als Bonus zu begreifen und entstammen unseren endlosen Gesprächen am Meer, die dann oft vom Hundertsten zum Tausendsten führten. Ich notierte diese, zum Grundverständnis nicht unbedingt elementaren Fragen und verschob die Beschäftigung mit ihnen auf den Moment, wenn die zwei Hauptfragen geklärt wären. Und an diesen verbissen wir uns weiterhin gewaltig. Schließlich kam ich immer mehr zu der Ansicht, dass mir vielleicht das naturwissenschaftliche, mathematische Rüstzeug fehlt um die Berechnungen der Gezeitenzeiten in ihrer komplexen Formelerklärmacht vollends zu begreifen. Es fehlte ganz offensichtlich an Erklärungen, die in der Lage waren, derlei komplexe Berechnungen so zu vermitteln, dass man die einzelnen Berechnungen nicht selbst im Detail nachvollziehen muss. Ich weiß, Wissenschaftsvermittlung, wie immer ein ganz kniffliges Ding.
Wäre das nicht eventuell der passende Moment um dieser KI, von der aktuell die ganze Welt redet, mal eine Chance zu geben? Nun, ihre Antworten gingen zumindest über die erlebte Standardantworten von Humanoiden („hat was mit dem Mond zu tun“) hinaus. ChatGPT offeriert vier Punkte, die hierzu beachtet werden wollen:
- Geografische Lage: Die Form der Küstenlinie und die geografische Lage eines Ortes können dazu führen, dass das Wasser zu unterschiedlichen Zeiten ein- und ausströmt. Engere Buchten oder Flussmündungen können dazu neigen, unterschiedliche Gezeitenmuster zu haben als offene Küstenabschnitte.
- Topographie des Meeresbodens: Die Tiefe und Form des Meeresbodens in einer bestimmten Region kann die Bewegung der Gezeitenströmungen beeinflussen. Engstellen, Unterwasserschwellen oder Meeresrinnen können dazu führen, dass sich das Wasser schneller oder langsamer bewegt und somit unterschiedliche Gezeitenzeiten erzeugt.
- Gezeitenkräfte: Die Anziehungskraft des Mondes und der Sonne auf die Erde verursacht Gezeiten. Diese Kräfte sind nicht überall auf der Erde gleich stark, was zu unterschiedlichen Gezeitenzeiten führt. Orte, die dem Mond oder der Sonne näher sind, können höhere Gezeitenausschläge und unterschiedliche Gezeitenzeiten aufweisen.
- Küstenform: Die Form der Küste und die Art der Küstengebiete, wie Lagunen oder Flussmündungen, können die Gezeitenmuster beeinflussen. Diese Eigenschaften können dazu führen, dass sich das Wasser schneller oder langsamer bewegt und zu unterschiedlichen Zeiten steigt oder fällt.
So weit so gut, aber tatsächlich waren uns diese Punkte bekannt, auch wenn sie so schön und fein säuberlich zusammengefasst, nach all den konfusen Diskussionen sehr beruhigend wirkten. Dennoch blieben wir unbefriedigt zurück, weil es sich hierbei ja erneut um eine abstrahierende Auflistung der Faktoren handelte, es aber nicht im mindesten erklärte, wie man all diese Variablen (von denen einige ja nun alles andere als konstant waren) in eine oder mehrere Gleichung brachte, um den Menschen an der Küste Tag für Tag solide Voraussagen des künftigen Hoch- und Niedrigwassers zu präsentieren. Aber gut, zweiundvierzigseidank wissen wir, dass Antworten bekanntlich nur so gut wie die Fragen sein können. Daher hakte ich nach und fragte, wie so etwas denn zu berechnen sei. Die Antwort ließ leicht durchschimmern, dass man unsere behäbige Biomasse nicht mit derlei komplexen Aufgaben belästigen wolle.
Verwenden Sie Gezeiten-Tabellen: Gezeiten-Tabellen sind in gedruckter Form oder online verfügbar und enthalten Informationen über die erwarteten Zeiten und Höhen von Hoch- und Niedrigwasser für verschiedene Orte entlang der Küsten. Sie können diese Tabellen verwenden, um die Gezeiten für einen bestimmten Ort zu finden. Es gibt auch mobile Apps und Websites, die Gezeiteninformationen in Echtzeit oder im Voraus liefern.
ChatGPT-3.5
Doch so weit gekommen, lass ich nicht locker und frage nur leicht genervt wie man denn diese Ergebnisse der Gezeiten-Tabellen berechnen kann und erhalte erneut eine, wie mir scheint, recht hinhaltende und beschwichtigende Antwort. Es gäbe hierfür verschiedene Wege, räumt der Algorithmus zögernd ein, die da wären: Astronomische Faktoren (gehoben für „hat mit dem Mond zu tun“), Küstengeographie (hatten wir schon, aber wie kann man eben diese doch recht variablen Faktoren in allgemeingültige Formeln pressen?), historische Daten (dieser Faktor taucht hier erstmals auf und lässt verschmitzt zu den Zusatzfragen blinzeln) und mathematische Modelle (diese würden die oben genannten Faktoren berücksichtigen, seien aber sehr komplex und würden numerische Berechnungen erfordern – also lass es besser bleiben Humanoid!).

Ein erneutes Nachhaken offenbarte, dass wir hier wohl auf etwas gestoßen waren, was eben mal nicht so nebenher, nach ein wenig Recherche vereinfacht vermittelt werden kann. Erstmals kommt man nun auf die verwirrende Welt der Gezeitenkomponenten zu sprechen. Es werden Gezeitenpotenzialmodelle erwähnt, die die Gezeitenkräfte in verschiedene harmonische Komponenten zerlegen, welche dann als Gezeitenkomponenten bezeichnet werden. Die häufigsten sind die Hauptkomponenten M2 (Hauptmond-Gezeiten), S2 (Hauptsonnen-Gezeiten), K1 (erste Mondaufsteigende Gezeitenwelle) und O1 (erste Mondabsteigende Gezeitenwelle), aber es gibt viele weitere…


Natürlich schließt die KI mit den gleichermaßen warnenden wie tröstenden Worten, dass es „verschiedene Versionen und Variationen dieser Modelle“ gäbe, welche ihrerseits „von Wissenschaftlern und Gezeitenforschern verwendet werden, um genaue Gezeitenvorhersagen für verschiedene Orte auf der ganzen Welt zu erstellen.“ Aber nur für den Fall, dass das bei all den zuvor getroffenen Antworten nicht deutlich genug rübergekommen sein sollte, mahnt sie oberlehrerhaft: „Diese Modelle können sehr komplex sein und erfordern leistungsfähige Computer zur Durchführung der Berechnungen.“ Was bleibt uns, „vom Affen abstammenden Bioformen, die so erstaunlich primitiv sind, dass sie Iphones [zeitgemäße, aber 100%ig adequate Anpassung] noch immer für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten“, anderes übrig, als jeden Tag, den man geschenkt bekommt, um dieses außergewöhnliche Naturspektakel zu erleben, schlicht und einfach mit Staunen zu verbringen.
Entdecke mehr von Viva Peripheria
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.