- Warum es wieder losgeht oder eine neuerliche Hamsterradkritik
- Von Friedrichshain über Friedrichshain hin zu böhmischen Dörfern
- Von tschechoslowakischen Höhen und Tiefen
- Diashow, die erste: Von Heidesee bis fast zum Triglav
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (1) von Altungarisch bis Walachei
- Über idyllische Plattitüden und endloses Grün
- Über das januszipfelige Istrien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (2) von Adige bis Theodor Mommsen
- Reisen nach Zahlen – 100 Tage
- Von einer die auszog das Fürchten zu verlernen
- Der italienischen Reise erster Teil
- Die besten Gerichte von draussen
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (3) von Basilikata bis Wildschwein
- Der italienischen Reise zweiter Teil
- Der italienische Reise dritter Teil
- Einblicke ins Reisetagebuch
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (4) – Von Ätna bis Zitrusfrüchte
- Reisen nach Zahlen – Tag 200
- Währenddessen in Afrika
- Così fan i tunisini
- Eisenbahnfahren in Tunesien
- Von Menschenhaufen und anderen Platzhengsten
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (5) von Agave bis Tuareg
- Tunesien – auf der Suche nach der Pointe
- Reisen nach Zahlen – Tag 300
- Sardinien – der italienischen Reise letzter Teil?
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (6) von Asinara bis Tafone
- Kleine, feine Unterschiede
- Im Autokorsika über die Insel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (7) von Elba bis Tarasque
- Fahrradfahren (u.v.m.) wie Gott in Frankreich – erste Eindrücke
- Jahrein, jahraus, jahrum
- Ausrüstung für Langzeitreisende – ein paar grundlegende Gedanken
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (8) von Baselstab bis Wasserscheidenkanal
- Reisen nach Zahlen – Tag 400
- Querfeldein und mittendurch – Frankreich vom Rhein bis zum Atlantik
- Wissensstrandkörner aus dem Reisewatt – Gezeiten-Sonderausgabe
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 (Frankreich)
- Projekt-Radria-Gleiche (Tag 426)
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (9) von El Cid bis Wanderdüne
- Der Jakobsweg – ein fader Pfad im Kurzporträt
- Ratgeber: Fahrradfahren auf dem Eurovelo 1 (Velodyssée)
- Unter Jakoblingen – von den Pyrenäen bis ans Ende der Welt
- Wissensplitter aus dem Reisesteinbruch (10) von Don Sueros de Quiñones bis Saudade
- Reisen nach Zahlen – 500 Tage
- Kopfüber durch Portugal und zurück
- Aus dem Reiseplanungslabor: Arbeitskreis Westafrika
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (11) von Azulejos bis Wasserballastbahn
- Meerdeutigkeit
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (12) Von Al-Andalus bis zu den Säulen des Herakles
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (13) von Alcazaba bis zur Unbefleckten Empfängnis
- Andalusien – ein Wintermärchen
- Reisen nach Zahlen – 600 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (14) von Flysch bis Trocadéro
- Rowerem przez peryferie
- Von Aisha Qandisha bis Moulay Idriss (15) Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch
- Jauchzend betrübt – die Packungsbeilage für Marokko
- Marokkohochjauchzende Menüvorschläge
- Reisen nach Zahlen – 700 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (16) von Corniche bis zur Via Domitia
- Die „Reiß-dich-am-Riemen“-Tour oder Radwandern für Durchgeknallte
- Ratgeber: Radfahren auf dem Eurovelo 8 – „La Méditerranée“
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (17) von Bektaschi bis Vučedol
- Giro della Jugoslavia
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 – das Balkankapitel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (18) von Chinesischer Jujube bis Ъъ
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch – MYTHOLOGIESPEZIAL – eine kleine Umschau des Irrsinns
- Was wurde eigentlich aus dem Römischen Reich? Eine ausführliche Inventur der verbliebenen Provinzen
- 852 Tage – Doppelt hält besser
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (19) von Atatürk bis Tigris
- Von Bačka Palanka zum Goldenen Vlies – Endspurt zum Kaukasus
- Z Nysy do Nysy
- Jahresrückblick 2024
- Reisen nach Zahlen – Tag 900
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (20) von Chichilaki bis zum Schutzvertrag von Georgijwesk
- Pflanzen, die es geschafft haben
- EIL: Wie man eine geschlossene Grenze überquert – auf dem Landweg von Georgien nach Aserbaidschan
- Reisen nach Zahlen – 1000 Tage
- Georgien – Winterschlaf im Schatten des Kaukasus
- Kurzanleitung: Mit dem Schiff von Aserbaidschan nach Kasachstan
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (21) von Avtovağzal bis Tamada
- А вы откуда? Mit dem Rad durch Aserbaidschan
- Wissenssplitter aus den Reisesteinbruch (22) von Aralkum bis Zoroastrismus
- Ratgeber: Wandern im Fan-Gebirge (Tadschikistan)
- Seitenstrasse – Seidenstrasse: Mit dem Rad vom Kaukasus nach Zentralasien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (23) von Aalam Ordo bis Yssyk-Köl
- Reisen nach Zahlen – 1100 Tage
- Elf Anekdötchen aus 1111 Reisetagen
- Ratgeber: Mit Rad, Baggage und Eisenbahn durch Zentralasien
- Mein Drei-Tage-China – der Ersteindrucks-Cocktail
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (24) von Apfel bis Yak
- Willkommen in Stania – die Fantastischen Vier Zentralasiens
- Reisen nach Zahlen – Tag 1200
- Die Mongolei – wie alles war, bevor alles begann
- Ratgeber: Südkorea und die besten Radwege der Welt
- Ratgeber: Osaka-Shanghai per Schiff
- Japan – selten so gelacht!
- Le Grand Prix de l’Asievision – die besten Ohrwürmer vom Kaukasus bis Japan
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (25) von 108 bis མཐུན་པ་སྤུན་བཞི།
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (26) Japan-Spezial
- Volkssport Karaoke – ein hellhöriger Streifzug durch Ostasien
- Wie ich im vietnamesischen Straßenverkehr das Vertrauen in die Menschheit zurückgewann
- Reisen nach Zahlen – Tag 1300
Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Kirgisen gab es vor gar nicht so langer Zeit sieben geschlossene Städte, und zwar Mailuu-Suu, Ming-Kusch, Kajy-Sai, Schakavtar, Sumsar, Ak-Tuez und Orlovka. Doch Moment mal, geschlossene Stadt, das klingt aber gar nicht nett und irgendwie auch nicht so offen wie wir die Kirgisen kennengelernt haben. In der Tat handelte es sich bei geschlossenen Städten meist um militärische Stützpunkte oder Standorte der Rüstungs- und Nuklearindustrie, die nicht auf frei erhältlichen Landkarten verzeichnet waren. Sie zeichnen sich zusätzlich durch ein gerüttelt Maß an grimmig dreinblickenden Kontrollposten, bewaffneten Sicherheitskräften und Sicherheitszäunen aus. Keine schöne Sache dies, aber in modernen Zeiten ein gar nicht so seltenes Phänomen und nicht ausgestorben keineswegs mit der Sowjetunion ausgestorben.
Wir besuchten nur eine der glorreichen Sieben und zwar Ming-Kusch, eine der ersten und wichtigsten Uranminen der Sowjetunion. Ming-Kusch bedeutet „Tausend Vögel“ und war einstmals eine der schönsten und fortschrittlichsten Städte Kirgistans. Denn man darf nicht übersehen, dass es auch Vorteile gab bei den geschlossenen Städten. Diese Städte wurden mit allem Notwendigen versorgt, das Angebot an Lebensmitteln und anderen Waren war sogar größer als im Rest des Landes. Der Bergbau bot viele Arbeitsplätze, die Löhne lagen 50–100% über dem landesüblichen Verdienst. Ming-Kusch hatte deshalb eine sehr gute Reputation und die Menschen schrieben sich auf Wartelisten ein, um in dort zu arbeiten. Es galt als das „Moskau Zentralasiens“ – ein Attribut, welches heute einerseits etwas schräg daherkommen mag und andererseits nur noch mit Mühe in den maroden Gebäuden und verwitterten Anlagen erkennbar ist.





Heute ist von der ehemals ruhmreichen Zeit des Bergarbeiterparadieses nur noch eine bedenkliche Umweltbelastung (440.000 Tonnen teilweise unsachgemäß gelagertes radioaktives Material) und die triste Perspektive des Steinkohleabbaus für die verbliebene Dorfbevölkerung übrig.
Kein Wissenssplitter kommt in den letzten Monaten ohne essentielle Schafsneuigkeiten aus, so auch dieses Mal. In Kirgistan aß und erfuhr ich vom Marco-Polo-Schaf (Ovis ammon polii), welches eine Unterart des Argali ist und als das größte Wildschaf der Welt gilt. Es ist bekannt für seine imposante Größe und seine riesigen, spiralförmigen Hörner, deren Spannweite bis zu 140 cm erreichen kann. Es hat die längsten Hörner aller Schafe. Das längste jemals gemessene Horn misst übrigens 1,90 m und wiegt 27 kg.

Lange haben wir uns im Römischen Reich herumgetrieben, doch hier, wo wir uns gerade aufhalten, in einer Gegend, wo bei den meisten Menschen sich die geographische Verortung auflöst, waren sie ja nun wirklich nicht, die Römer, sollte man meinen. Doch es gibt da eine Theorie, die an ein Asterix-Abenteuer erinnert, aber tatsächlich seriöse Historiker beschäftigt: Mit drei Legionen samt Hilfstruppen zog im Jahr 53 v.Chr. ein gewisser Crassus nach Mesopotamien, doch bei Carrhae (Harran) traf er auf den Feind und verlor die Schlacht und sein Leben. 20.000 Römer sollen dabei umgekommen sein. Diese schallende Klatsche gegen die Parther, galt lang als eine der größten Katastrophen der römischen Geschichte.
Soviel zu den harten historischen Fakten. Nun wird es etwas nebulöser. 17 Jahre später erschien eine Armee der chinesischen Han-Dynastie im heutigen Kasachstan. Ihr Ziel war die Disziplinierung des Steppenvolks der Xiongnu. Als die Truppen deren Hauptstadt Taras belagerten, strömten „über hundert Fußsoldaten aus dem Tor und bildeten eine Fischschuppen-Formation“. Nach der, trotzdem gelungenen Eroberung wurde die Truppe nach China deportiert und dort in einer neu gegründeten Stadt namens Li-xian (Liqian) angesiedelt, erzählt das „Buch der Späteren Han“. Dann verliert sich ihre Spur.
In besagten Liqian, welches in einem verarmten Landkreis im nördlichen China liegt, nutzt man diese diffusen Anhaltspunkte aus längst vergangener Zeit natürlich um sie nach allen Regeln der Touristikkunst auszuschlachten. Und warum auch nicht?! Es gibt in der Tat haarsträubendere und absurdere Anlässe um mit Geschichte Geld zu machen als diese. Schließlich gibt es hier auch eine ungewöhnliche hohe Zahl ortsansässiger Leute mit westlichen Charakteristika – grüne Augen, große Nasen, und sogar mit blondem Haar – vermischt mit traditionellen chinesischen Merkmalen. Oder spielen hierbei vielleicht doch die Hephtaliten, die „Weißen Hunnen“ eine Rolle, oder taten sich diese eventuell mit den Römern zusammen um später mit den Chinesen zu kuscheln? Moment mal, Weiße Hunnen, was waren das gleich nochmal für Leute? Ja, so genau weiß das mal wieder keiner. Mit den eigentlichen Hunnen, die sich irgendwann aufmachten um das Römische Reich zu ruinieren, haben sie wohl herzlich gemein. Sie sind wahrscheinlich mit den Trochaern und/oder den Iranern verwandt und fielen schon früh durch ihr ungewöhnliches Äußeres auf:
Frühe chinesische Chroniken berichten von grotesken Barbaren an der Westgrenze des Landes, weißhäutigem Gesindel mit flammenden Haar, riesigen Nasen und grünen oder blauen Augen. Im Laufe des 1. Jahrtausends gerieten diese Fremden jedoch in Vergangenheit, sodass die westlichen Archäologen von ihren Funden überrascht wurden. Mittlerweile sind die rätselhaften Mumien in der gesamten Taklamakan aufgetaucht, einige in keltisch anmutende Karomuster gekleidet, andere mit Hexenhüten.
Thubron, Colin: Reiseabenteuer im Schatten der Seidenstraße
Zurück nach Kirgistan, Schlaglicht auf ein außergewöhnliches Epos, von dem garantiert kaum einer in Europa je gehört hat. Die Rede ist von „Manas“. Einem wahnsinnigen Werk mit einem Gesamtvolumen von drei Kapiteln, welche zusammen etwa 500.000 Zeilen beinhalten. Dies ist etwa zwanzigmal so groß wie die Ilias und Odyssee der alten Griechen .Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Epos “Manas” von Jahrhundert zu Jahrhundert, vom Vater zum Sohn, von Generation zu Generation weitergegeben. Die Hauptidee des Manas-Epos ist die Einheit in einem Ganzen, der Kampf um die Unabhängigkeit.

Der traditionelle Hut der Kirgisen heißt Kalpak (oder Ak-Kalpak) und ist ein weißer Filzhut für Männer, der für seine symbolische Bedeutung und praktische Funktion bekannt ist. Er ist hochgekrönt, hat eine scharfe Verjüngung und ähnelt einem schneebedeckten Berg, was die Berge Kirgisistans symbolisieren soll. Sehr hübsch zweifellos und dennoch konnte ich meine Zweifel nie ganz ablegen, dass die Männer, die Hüte lachend abnehmen würden, sobald der letzte Tourist verschwunden wäre.

An dieser Stelle wurde schon das ein oder andere Mal über Zentralasien als uralte Quelle von Domestikation und Zucht gesprochen. Viele Kulturpflanzen haben in dieser Region ihre Ursprung, aber eine übte auf mich einen nahezu mythischen Reiz aus – der Apfel. Dies liegt nicht nur daran, dass ich diese Frucht sehr schätze, seinen Baum sehr mag, nein, der Apfel ist natürlich auch kulturell sehr aufgeladen und so war die lang erträumte Reise nach Almaty auch stets eine Reise hin zu den schattigen Bergtälern mit ihren seit Ewigkeiten dort gedeihenden Uräpfel-Hainen.

Lange wurde vermutet, dass der Holzapfel (Malus sylvestris) die Stammform des Kulturapfels sei. Heute weiß man, dass diese Vermutung falsch war. Der Kulturapfel ist ein direkter Abkömmling des asiatischen Wildapfels (Malus sieversii) aus dem zentralasiatischen Tian-Shan-Gebirge. Die Herkunft des Kulturapfels ist erst seit Kurzem definitiv geklärt. Erst 2012 wurde sein Erbgut entschlüsselt und damit zweifelsfrei nachgewiesen, dass sein Ursprung hier im abgelegenen Tian-Shan-Gebirge liegt. Die ursprüngliche Domestizierung des Kulturapfels aus Malus sieversii aus dem Tian Shan lässt sich 10.000 Jahre zurückverfolgen und geschah durch die dortigen Nomaden. Der domestizierte Apfel Malus domestica unterschied sich anfänglich genetisch und phänotypisch kaum von seinen wilden Vorfahren. Erst später, auf dem Weg über die Seidenstraße nach Westen, erfolgte eine Diversifizierung durch Gen-Introgression (gelegentliche Hybridisierung) mit drei weiteren wilden Apfelarten (M. baccata, M. orientalis und M. sylvestris).

Die Vorgeschichte um die Entdeckung des Malus sieversii ist dabei eine überaus interessante. Bereits im 19. Jahrhundert wurde der Ur-Apfel vom deutschen Pharmazeuten Carl Sievers beschrieben. 1929 entdeckte dann der russische Biologe Nikolai Vavilov (1887–1943) die Apfelwälder im Tian-Shan-Gebirge. Aufgrund ihrer hohen Diversität vermutete er, den Ursprung des Kulturapfels gefunden zu haben. Vavilov nahm dann ein tragisches Ende. Die dumpfe Wissenschaftsfeindlichkeit des Stalinismus wurde ihm Verhängnis. Er wurde wegen seiner angeblich „bürgerlichen“ Wissenschaft verfolgt (gemeint war hier die Genetik). Er starb 1943 im Gulag. Einer seiner Schüler war der kasachische Agronom Aymak Djangaliev (1913–2009), später selbst Opfer stalinistischer Verfolgung, war schockiert über die Zerstörung der Apfelwälder in Kasachstan während der Sowjetzeit und studierte die Äpfel und ihre Biologie aufgrund der Hypothese Vavilovs. Er konnte schließlich nachweisen, dass Malus sieversii tatsächlich alle vererbbaren Merkmale des Kulturapfels besitzt. Aber am faszinierendsten ist, dass Djangalievs Untersuchungen eine andere Hypothese seines Lehrers bestätigten: Im abgeschiedenen Gebirge des Tian-Shan entstand im Verlauf von Jahrmillionen eine für den Menschen bedeutende Obstart durch unbewusste und erst später bewusste Züchtung, sondern durch die Gefräßigkeit von Bären. Es waren nämlich die Bären dieser Region, die vor allem die süßesten Früchte von Malus sieversii fraßen und dadurch für die evolutive Entstehung des Vorläufers unseres Kulturapfels verantwortlich waren. Die Samen von Malus sieversii keimen erst, nachdem sie den Darm eines Bären passiert haben, und diese schlagen sich heute noch regelmässig die Bäuche mit Äpfeln voll.

Die Legende um Panfilows 28 Helden, die dem deutschen Angriff in der Schlacht um Moskau 1941 der Legende nach tapfer bis zum Tode standhielten, ist jedem Russlandbesucher ein Begriff, überraschend kam für mich nun die häufige Präsenz von Panfilow in Zentralasien, speziell in Kasachstan. In Almaty steht direkt in Front der Zuckerbäckerzwiebelkirche (Christi-Himmelfahrt-Kathedrale) ein trutziges Denkmal, allerorten sind Straßen und Plätze nach ihm benamst und mit Sharkent hieß bis vor kurzem noch eine ganze Stadt nach ihm.

Nun ist hier nicht der Ort und die Zeit um den Wahrheitsgehalt der Legende nachzuspüren. Nur soviel, man verwendet hier nicht grundlos das Label Legende. Warum nun aber wird Panfilow in dieser Region vergleichsweise viel Anerkennung entgegengebracht? Das ist bei einem Blick auf seine Biographie ziemlich schnell erklärt. Denn er spielte vor seinem Auftritt in der Schlacht um Moskau eine bedeutende Rolle in Zentralasien. So war er Chef des Mittelasiatischen Militärbezirks bzw. Militärkommissar der Kirgisischen SSR.
Und damit wechseln wir endgültig den Kontinent (Ostasien), achwas, den Planeten und lassen uns einmal gründlich kultur-, sprach- und allgemeinschocken – China. Nach den hier verbrachten zwei Wochen könnte ich natürlich aus einem überschäumenden Topf an Missverständnissen, Erkenntnissen und anderen Wunderlichkeiten schöpfen, doch belassen wir es für den Anfang bei ein wenig Staatspropaganda und widmen uns dem überall in Xingjiang zu bestaunenden Granatapfelkerndogma.





Es sollte allgemein bekannt sein, dass China keinesfalls aus einer homogenen Masse von anderthalb Milliarden Einheitschinesen besteht. Es mag zwar nur eine Partei, eine Zeitzone und eine Geschichte geben, aber hinsichtlich ethnischer Minderheiten erkennt man in Peking gönnerhaft 56 verschiedene Gruppen an. Und damit da keine Unruhe entsteht, hat man sich diese entzückende Metapher mit den Granatapfelkernen gebastelt. Das versteht auch noch der widerborstigste Uigure: Obwohl es sich um viele verschiedene Kerne handelt, gehören natürlich alle zusammen zu einem Ganzen, im übertragenen Sinne, der chinesischen Nation. Was für eine wunderschöne, fruchtbare und noch dazu rote Frucht!
Falls man sich in den ersten Momenten, Tagen, Wochen China wundert (und mit Verlaub gesagt, jeder Europäer, der sich hier nicht ununterbrochen wundert, ist entweder ein privilegierter Schnösel oder ein komplett desinteressierter Hans-guck-in-die-Luft) über diesen massiven und allgegenwärtigen Geschäftssinn, den gnadenlosen Konsumismus, dem sei gesagt, der Schlüssel zum Verständnis liegt, wie so oft, in der Flagge. Denn wofür stehen denn die fünf goldenen Sterne auf der chinesischen Fahne? Der größte, den die vier restlichen artig umkreisen, symbolisiert natürlich die Kommunistische Partei. Aber die restlichen Sternchen? Auf die ersten beiden kommt man leicht: Einer für die Arbeiter, der andere für die Bauern natürlich. Doch die anderen beiden Sternchen irritieren einen linienfesten Salonbolschewisten wie mich natürlich, rücken aber das Treiben hierzulande in ein verständliches Licht: Der eine vertritt die Kleinbürger (vulgo Spießer) und der andere eine diffuse, gesellschaftliche Gruppe namens „patriotische Kapitalisten“. Nun, das erklärt einiges, dem muss kaum etwas hinzugefügt werden.
Ganz anders fühlt es sich nicht nur hinsichtlich der Flagge beim unscheinbar wirkenden, nördlichen Nachbarn an. Das Symbol auf der mongolischen Fahne hat jeder diffus im Hinterkopf, aber die genaue Bedeutung erschließt man sich selbstverständlich erst vor Ort wenn man sie unablässig im straffen Steppenwind flattern sieht. Es handelt sich hierbei um das Sojombo-Symbol und in diesem steckt einiges.

Die Elemente des Sojombo-Symbols tragen in der Mongolei folgende Bedeutungen (von oben nach unten):
- Feuer gilt allgemein als Symbol für Wohlstand und Erfolg. Die drei Zungen der Flamme stehen für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
- Sonne und Mond sind alte Symbole des Tengrismus (dazu später mehr) für „Vater Himmel“.
- Die beiden Dreiecke deuten die Spitze eines Pfeils oder Speeres an. Sie zeigen beide abwärts, um auf die Niederlage der inneren und äußeren Gegner hinzuweisen.
- Die beiden horizontalen Rechtecke geben der runden Form Stabilität. Die rechtwinklige Form steht für Ehrlichkeit und Gerechtigkeit der Menschen in der Mongolei, egal ob sie in der Gesellschaft oben oder unten stehen.
- Die beiden Fische entsprechen dem chinesischen Yin-Yang-Zeichen, welches die gegenseitige Ergänzung von Mann und Frau darstellt. Im Sozialismus wurden sie alternativ als Symbol der Wachsamkeit gelesen, da Fische ihre Augen nie schließen.
- die beiden vertikalen Rechtecke können als Festungsmauern interpretiert werden und stehen für Zusammenhalt und Stärke gemäß dem mongolische Sprichwort „Zwei Menschen in Freundschaft sind stärker als Mauern aus Stein“.
Na, das nenne ich doch mal ne komprimierte, massive Aussage. Dazu sieht sie auch noch gut aus. Beeindruckt räume ich der mongolischen Fahne einen Platz in meiner Top 10 einb, auch wenn ich die Kombination von rot und blau an sich nicht so mag. Aber was war das nochmal mit diesem Tengrismus?
Hierbei handelt es sich um einen Sammelbegriff für die alte, ursprüngliche Religion der Mongolen und Turkvölker Zentralasiens. Wie das mit Sammelbegriffen zum einen und religiösen Schubladen zum anderen so ist, lässt sich das alles sehr schwer ein- und abgrenzen. Der Tengrismus ist seinerseits aus dem altaischen Schamanismus oder Animismus hervorgegangen oder auch nicht hervorgegangen, vielleicht wabern beide Religionen friedlich neben einander her. Man weiß es nicht so genau. Doch allein wenn ich hier andeute, dass wir es mit Animismus zu tun haben, ahnt der geschätzte Glaubensexperte, was wir hier für ein riesiges Fass aufmachen. Kurz gesagt ist der Tengrismus ein solider Cocktail aus Animismus, klassischen Schamanismus, Ahnenverehrung und einer speziellen Form des Totemismus. Zentrales Element ist, wie könnte es in einem derart beeindruckend zweidimensionalen Land wie der Mongolei anders sein, der Himmelsgott Tengri!
Tngri, Tengri oder Tegri ist die Bezeichnung für die Götter oder höchsten geistigen Wesen im mongolischen Schamanismus. Wie viele dieser Wesen es gibt, ist nicht wirklich bekannt. Wo kämen wir denn da hin wenn wir die genaue Zahl kennen würden, da könnte man ja gleich die Wolken inventarisieren. Übrigens ist auch Dschingis Khan eine, wenn nicht sogar die Verkörperung des höchsten Tengri.
Das höchste Ziel der Anhänger der Tengris ist, mit „allem, was unter dem Himmel ist“, also mit seiner Umwelt, im Einklang zu leben. Der Mensch steht in der Mitte der Welten und sieht seine Existenz geborgen, zwischen dem „ewigen blauen Himmel“ (Mönkh khökh Tengeri auf Mongolisch), der „Mutter Erde“ (Gazar Eje auf Mongolisch), die ihn stützt und ernährt, und einem Herrscher, der als „Sohn des Himmels“ gilt. Mit einer ausgeglichenen Lebensweise hält der Mensch seine Welt im Gleichgewicht. Er strahlt seine persönliche Kraft aus, sein „Windpferd“. Der Kosmos, die Naturgeister und die Ahnen sorgen dafür, dass es dem Menschen an nichts fehlt und beschützen ihn.

Heute ist die Gestalt des Himmelsgottes Tengri vorwiegend bei Mongolen, wo auch der Lamaismus von Bedeutung ist, und einigen noch naturverbunden lebenden Turkvölkern wie Chakassen, Altaier oder Jakuten erhalten geblieben. Nach all dem schuldverwurzelten Monotheismus eine wirklich spannende, erfrischende Sache, der ich selbst als Atheist etwas abgewinnen kann. Und wenn ich jeden Tag nach oben schaue und diesen wahnsinnigen Himmel über der Steppe betrachte, kann ich diese Gedanken besser nachempfinden als so manch einen Schmarrn aus den Buchreligionen.
War hier gerade die Rede von einem Windpferd? Natürlich muss es ein Pferd sein, welches in der Mongolei im weitesten Sinne so etwas wie die Seele symbolisiert. Denn auf einer Fläche von ungefähr fünf Deutschlands leben neben drei Millionen Rindern (davon 500.000 Yaks), etwa 17 Millionen Schafe (weltweit die meisten Schafe pro Kopf), 20 Millionen Ziegen auch mehr als drei Millionen Pferde, was auf eine gewisse Weise überhaupt nicht verwunderlich, sondern eigentlich nur hochskaliert ist .Daran kann man also nur ablesen wie viele Menschen aktuell in der Mongolei leben, wobei das natürlich nur Schätzungen sind. Die letzten Volks- wie Pferdezählungen sind lange her.




Als wir aus dem umtriebigen Ameisenstaat China mit seinen lückenlosen Zäunen und Kulturlandschaften in die Mongolei hineinradelten, wurden wir zuerst erschlagen von der Unberührtheit der Erde. Das völlige Fehlen von Menschen und ihren Bauten ist das eine, aber das totale Fehlen einer wie auch immer gearteten Bearbeitung der Oberfläche war einzigartig. „So in etwa muss die Erde ausgesehen haben, bevor wir gekommen sind“, war ein Gedanke, der mir hier durch den Kopf ging. Eines der ersten Zeichen menschlicher Existenz waren Steinhaufen mit, im zornigen Wind wehenden Tuchfetzen. Ein Obo-Schrein (auch Ovoo genannt) ist eine schamanistische Felsskulptur oder ein Altar, der in der Mongolei und anderen Teilen Zentralasiens als religiöse Stätte oder Markierung von Wegen und Grenzen dient. Diese traditionellen Schreine bestehen typischerweise aus gestapelten Steinen und werden mit Hölzern und bunten Gebetsfahnen geschmückt, um Geister zu ehren oder Glück zu erbitten.
Und zum Schluss noch ein paar Worte zum Yak, dem wohl urwüchsigsten Bewohner der Mongolei, und das will was heißen! Die, von dem schwedischen Entdeckungsreisenden Sven Hedin sehr treffend als Grunzochsen bezeichneten Zottelwesen sind wirklich etwas ganz Besonderes. Ihr dichtes, langes Haarkleid berührt am Bauch fast den Boden und ermöglicht ihnen bei wahnsinnigen Temperaturen von -50°C zu überleben. Natürlich bringen diese erstaunlichen Kreaturen noch einiges mehr mit um in Hochgebirgsgefilden die arktische Temperaturen nicht nur zu überleben, sondern nebenher auch noch Fleisch anzusetzen und Milch zu liefern.

So ist bspw. die Luftröhre des Yaks auffallend dick und voluminös, die Schweißdrüsen sind schlecht ausgebildet, um Transpiration und den damit verbundenen Wärmeverlust weitgehend zu vermeiden. Die Hufe sind an den Außenseiten besonders hart, in der Mitte mit einer weichen Haut besetzt. Damit lässt es sich ebenso gut klettern wie auch beim Abstieg die Wucht des Körpers abfangen. Ein Yak-Bulle kann stolze 400 kg auf die Waage bringen, fast das Gewicht eines Pferdes, das Doppelte einer Kuh. Gezüchtet wurden die Rinder von den Bewohnern des Chuvsgul-Berglandes, Altai- und Khangai-Gebirges, wobei ca. 30% des mongolischen Gesamtbestands auf den Mongol-Altai entfällt.
Außerdem kommt dem Tier eine bedeutende Rolle als Transport- und Reittier zu, denn überraschenderweise ist es für die Gebirgsregionen mit ihren steilen Hängen dafür ideal geeignet. Ein ausgewachsener Ochse kann mit etwa 60kg Gepäck etwa 25 km am Tag zurücklegen oder er wird zum Ziehen einer Jurte genutzt. Ja, richtig gelesen, zum Ziehen einer Jurte. Durch den 1000-Tögrök-Schein wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das Herumtreiberdasein der alten Nomaden dann doch mehr mit dem Protz-Glamping aktueller Caravan-Kreuzer zu tun hatte als mit unserem puristischen Radnomadentum.

In ihrer Laktationsperiode gibt eine Yak-Kuh insgesamt 350 bis 400l Milch. Das ist zwar deutlich weniger als ein Rind, aber dafür mit einem fast doppelt so hohen Fettgehalt (zwischen 5 und 9%). Das muss so schnell wie möglich gekostet werden.
Entdecke mehr von Viva Peripheria
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
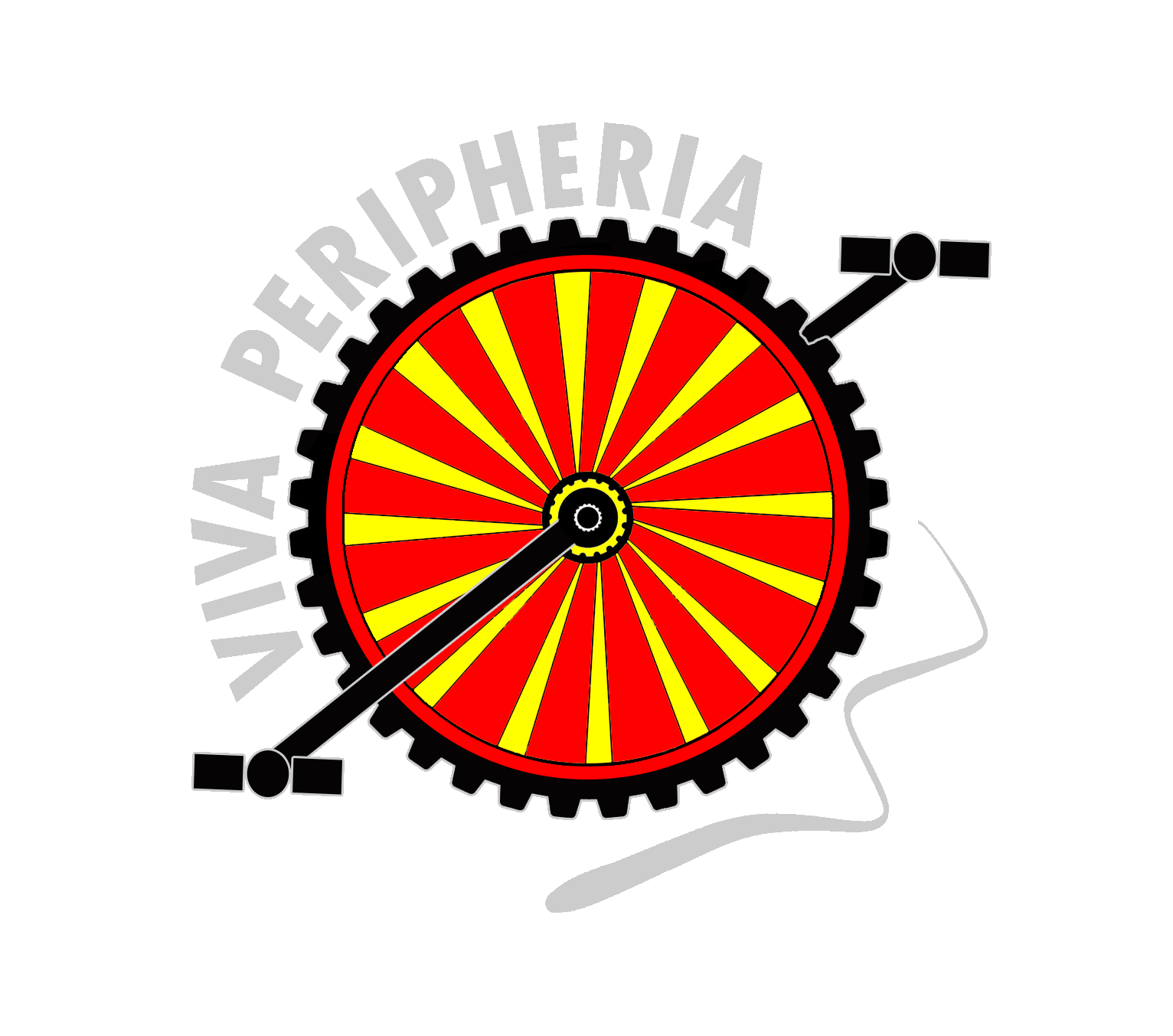

Pingback: Willkommen in Stania – die Fantastischen Vier Zentralasiens – Viva Peripheria