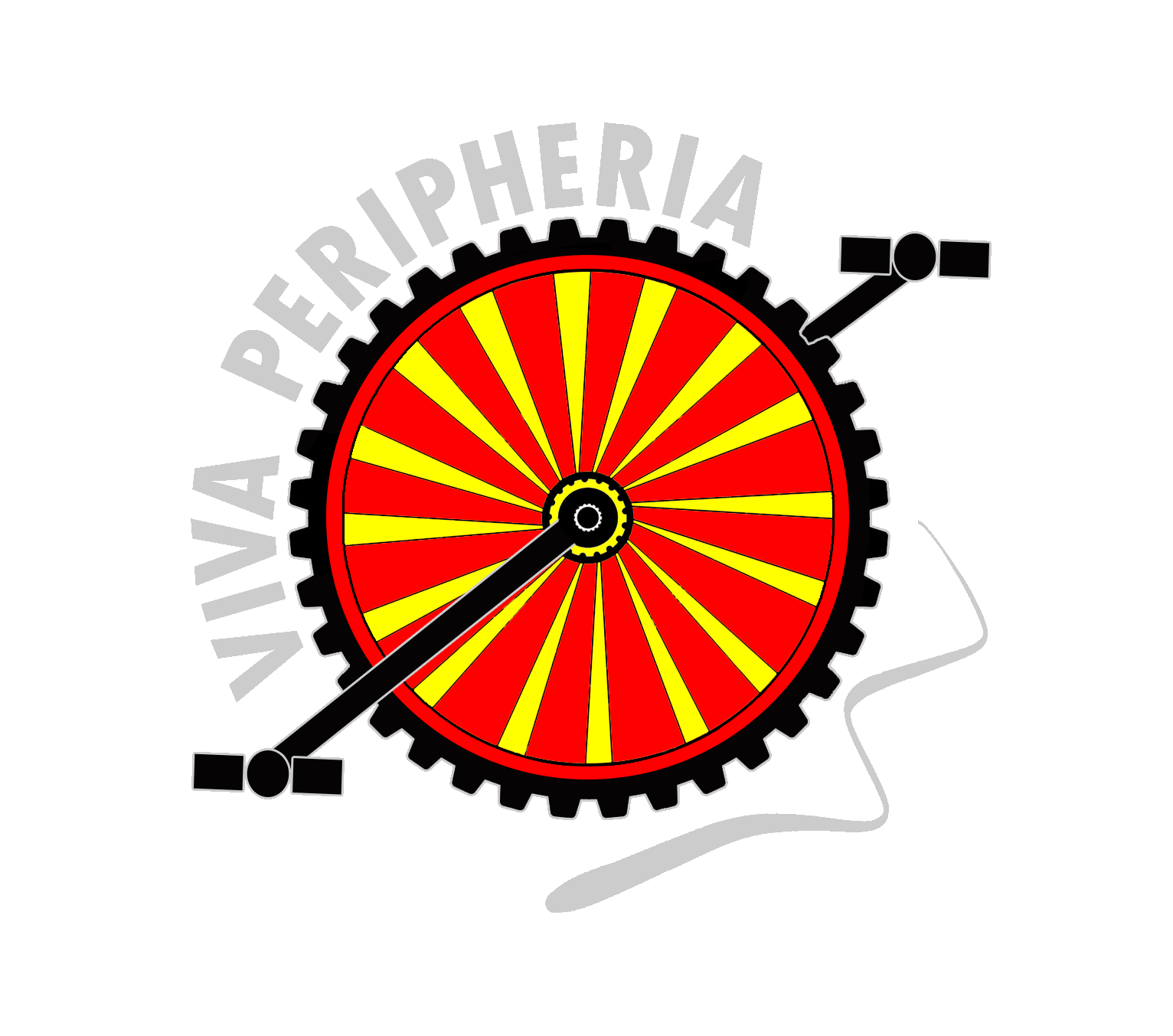- Warum es wieder losgeht oder eine neuerliche Hamsterradkritik
- Von Friedrichshain über Friedrichshain hin zu böhmischen Dörfern
- Von tschechoslowakischen Höhen und Tiefen
- Diashow, die erste: Von Heidesee bis fast zum Triglav
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (1) von Altungarisch bis Walachei
- Über idyllische Plattitüden und endloses Grün
- Über das januszipfelige Istrien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (2) von Adige bis Theodor Mommsen
- Reisen nach Zahlen – 100 Tage
- Von einer die auszog das Fürchten zu verlernen
- Der italienischen Reise erster Teil
- Die besten Gerichte von draussen
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (3) von Basilikata bis Wildschwein
- Der italienischen Reise zweiter Teil
- Der italienische Reise dritter Teil
- Einblicke ins Reisetagebuch
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (4) – Von Ätna bis Zitrusfrüchte
- Reisen nach Zahlen – Tag 200
- Währenddessen in Afrika
- Così fan i tunisini
- Eisenbahnfahren in Tunesien
- Von Menschenhaufen und anderen Platzhengsten
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (5) von Agave bis Tuareg
- Tunesien – auf der Suche nach der Pointe
- Reisen nach Zahlen – Tag 300
- Sardinien – der italienischen Reise letzter Teil?
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (6) von Asinara bis Tafone
- Kleine, feine Unterschiede
- Im Autokorsika über die Insel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (7) von Elba bis Tarasque
- Fahrradfahren (u.v.m.) wie Gott in Frankreich – erste Eindrücke
- Jahrein, jahraus, jahrum
- Ausrüstung für Langzeitreisende – ein paar grundlegende Gedanken
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (8) von Baselstab bis Wasserscheidenkanal
- Reisen nach Zahlen – Tag 400
- Querfeldein und mittendurch – Frankreich vom Rhein bis zum Atlantik
- Wissensstrandkörner aus dem Reisewatt – Gezeiten-Sonderausgabe
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 (Frankreich)
- Projekt-Radria-Gleiche (Tag 426)
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (9) von El Cid bis Wanderdüne
- Der Jakobsweg – ein fader Pfad im Kurzporträt
- Ratgeber: Fahrradfahren auf dem Eurovelo 1 (Velodyssée)
- Unter Jakoblingen – von den Pyrenäen bis ans Ende der Welt
- Wissensplitter aus dem Reisesteinbruch (10) von Don Sueros de Quiñones bis Saudade
- Reisen nach Zahlen – 500 Tage
- Kopfüber durch Portugal und zurück
- Aus dem Reiseplanungslabor: Arbeitskreis Westafrika
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (11) von Azulejos bis Wasserballastbahn
- Meerdeutigkeit
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (12) Von Al-Andalus bis zu den Säulen des Herakles
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (13) von Alcazaba bis zur Unbefleckten Empfängnis
- Andalusien – ein Wintermärchen
- Reisen nach Zahlen – 600 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (14) von Flysch bis Trocadéro
- Rowerem przez peryferie
- Von Aisha Qandisha bis Moulay Idriss (15) Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch
- Jauchzend betrübt – die Packungsbeilage für Marokko
- Marokkohochjauchzende Menüvorschläge
- Reisen nach Zahlen – 700 Tage
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (16) von Corniche bis zur Via Domitia
- Die „Reiß-dich-am-Riemen“-Tour oder Radwandern für Durchgeknallte
- Ratgeber: Radfahren auf dem Eurovelo 8 – „La Méditerranée“
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (17) von Bektaschi bis Vučedol
- Giro della Jugoslavia
- Ratgeber: Radfahren auf dem EuroVelo 6 – das Balkankapitel
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (18) von Chinesischer Jujube bis Ъъ
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch – MYTHOLOGIESPEZIAL – eine kleine Umschau des Irrsinns
- Was wurde eigentlich aus dem Römischen Reich? Eine ausführliche Inventur der verbliebenen Provinzen
- 852 Tage – Doppelt hält besser
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (19) von Atatürk bis Tigris
- Von Bačka Palanka zum Goldenen Vlies – Endspurt zum Kaukasus
- Z Nysy do Nysy
- Jahresrückblick 2024
- Reisen nach Zahlen – Tag 900
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (20) von Chichilaki bis zum Schutzvertrag von Georgijwesk
- Pflanzen, die es geschafft haben
- EIL: Wie man eine geschlossene Grenze überquert – auf dem Landweg von Georgien nach Aserbaidschan
- Reisen nach Zahlen – 1000 Tage
- Georgien – Winterschlaf im Schatten des Kaukasus
- Kurzanleitung: Mit dem Schiff von Aserbaidschan nach Kasachstan
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (21) von Avtovağzal bis Tamada
- А вы откуда? Mit dem Rad durch Aserbaidschan
- Wissenssplitter aus den Reisesteinbruch (22) von Aralkum bis Zoroastrismus
- Ratgeber: Wandern im Fan-Gebirge (Tadschikistan)
- Seitenstrasse – Seidenstrasse: Mit dem Rad vom Kaukasus nach Zentralasien
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (23) von Aalam Ordo bis Yssyk-Köl
- Reisen nach Zahlen – 1100 Tage
- Elf Anekdötchen aus 1111 Reisetagen
- Ratgeber: Mit Rad, Baggage und Eisenbahn durch Zentralasien
- Mein Drei-Tage-China – der Ersteindrucks-Cocktail
- Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (24) von Apfel bis Yak
- Willkommen in Stania – die Fantastischen Vier Zentralasiens
- Reisen nach Zahlen – Tag 1200
- Die Mongolei – wie alles war, bevor alles begann
- Ratgeber: Südkorea und die besten Radwege der Welt
Die Ätna – über ihre majestätische Ausstrahlung auf weite Teile der Insel wurde hier schon kurz gesprochen und ich denke, dass der größte aktive Vulkan Europas allgemein bekannt sein sollte. Wie die meisten wirklich spannenden Dinge auf unserer Welt sind beide Dimensionen, die mythische wie die wissenschaftliche, über alle Maßen unterhaltsam. Zu Zeiten der alten Griechen einigte man sich schnell auf die wahrscheinlichste aller Möglichkeiten – der zu antiken Zeiten noch deutlich aktivere Vulkan musste die Schmiede des Hephaistos sein. Und da dieser ja bekanntlich mit der schönsten Frau der Welt liiert war, die Beziehung aber alles andere als ausglichen gelten konnte, waren Eifersuchtsausbrüche an der Tagesordnung. Tja, und wenn so ein mit Feuer und flüssigen Metallen hantierender Gott zornig wurde, dann äußerte sich das halt in einem Vulkanausbruch. Und die Ätna brach oft aus… Die trockene Herangehensweise der ewigen Entzauberer aus der Wissenschaftsfraktion fördert dabei doch noch ein paar spektakulärere Fakten zutage, denn es handelt sich bei der Ätna nicht einfach nur um einen Vulkan, sondern mit nachweisbaren Lavaschichten bis 1500 v. Chr. ist sie zum Beispiel schon mal der älteste aktive Vulkan unseres Planeten. Dass an dieser Stelle Siziliens der Ätna entstand, liegt an der besonderen tektonischen Situation Süditaliens. Der Untergrund Siziliens ist alles andere als stabil. Im Mittelmeer südlich der Insel verläuft die Plattengrenze zwischen Afrika und Europa. Ein Teil der afrikanischen Platte schiebt sich seit längerer Zeit gemächlich unter den europäischen Kontinent und wird im Erdmantel aufgeschmolzen. Obwohl die Ätna wirklich sehr aktiv ist (nach Schätzungen des World Volcanology Institute traten hier mehr als 225 Vulkanausbrüche auf) bleiben die meisten Ausbrüche folgenlos (nur 77 Todesfälle wurden dem Vulkan zugeschrieben) außer jenem heftigen Ausbruch von 1669, der auf üble Weise die Insel verwüstet haben muss und nachdem man notdürftig alles wieder aufgebaut hatte, schon 1693 durch eines der schwersten Erbeben der Menschheitsgeschichte erneut alles zerstörte wurde, uns aber in Folge dessen eine der schönsten und durchgängigsten Barocklandschaften (siehe unten „Spätbarock in Sizilien“) des Universums bescherte.
Die unüberschaubar große Familie der Rautengewächse gehört vom Prinzip her in mein Ressort, sind doch die Mehrzahl der Familienmitglieder den Bäumen zuzuordnen. Speziell die Bäume aus der über alle Maßen verehrten Gruppe der Zitrusfrüchte wurden jedoch in meiner gesamten Laufbahn als Baumkontrolleur merkwürdigerweise nicht einmal erwähnt. Daher musste ich nun erst hier im Botanischen Garten von Palermo (den übrigens nicht nur der alte Goethe als den wunderbarsten Ort der Stadt empfand) erfahren, dass so etwas Köstliches wie Mandarinen oder Limetten erst seit dem 19. Jahrhundert existieren. Natürlich ahnte ich, dass die meisten heute geläufigen Zitrusfrüchte Züchtungen seien müssen. Sämtliche Obstbäume wie wir sie heute kennen, sind das. Aber der späte Zeitpunkt wie auch die verschiedenen (unten abgebildeten) Verwandtschaftsverhältnisse überraschten mich dann doch ein wenig.

Kommen wir zu einer neuen Kategorie in dieser kleinen, aber feinen Wissensschau: Ich habe Fragen. Fragen an euch. Zeit mal etwas zurückzugeben. Die Frage ist Folgende: Haben Engel Füße mit denen sie richtig laufen können? Und wenn ja, tragen sie Schuhe? Diese Frage treibt mich nun schon seit einigen Monaten um. Der Auslöser hierfür war, wie so oft, eine dieser spektakulären Fantasy-Exkurse der italienischen Katholen. Im Gargano gab es mit Sant’Angelo einen Wallfahrtsort zu dem erwachsene Menschen pilgern. Nicht um die spektakuläre Grotte, einen der letzten richtigen Wälder Italiens zu erleben oder einfach nur um einen genießerischen Blick auf das azurblaue Meer zu werfen. Nein, sie kommen um eine Vertiefung im Fels zu verehren, den sie als Fußabdruck des Erzengels Michael interpretieren. Dies ließ mich wie so oft bei den merkwürdigen Stilblüten eines ernstgemeinten Glaubens an offensichtlichen Blödsinn zutiefst irritiert zurück. Doch in diesem Fall hielt es etwas länger an, denn ich hatte die Füße von Engeln nie als vollwertige Gliedmaßen wahrgenommen. Eher als Extremitäten sekundären Ranges, die bestenfalls zum Landen und Rumstehen dienten. Doch als ich mich eingehender mit Engelsfüßen beschäftigte, musste ich eingestehen, doch Füße hatten sie schon alle, aber in laufender Bewegung wurden sie dennoch selten abgebildet. Die Schuhfrage war dagegen noch eine deutlich vielschichtigere. Meine These ist: schwebende Engel sind immer barfuß, stehende Engel tragen Sandalen und zwar ausschließlich. Ich habe jedenfalls noch keine Engelsabbildung gesehen auf der sie Halbschuhe oder mehr trugen.
Der Spätbarock in Sizilien ist ganz ohne Zweifel eine der oberflächlichen Aspekte warum man sich in Sizilien gleich von Anfang an anders fühlt als in Süditalien. Natürlich gibt es mit Städten wie Lecce, Trani oder natürlich ihrer Majestät Neapel in Süditalien auch einige vorzügliche Beispiele für derlei lustvoll an einem vorbeitänzelnde Städte. Doch mit dem „Val di Noto“ haben wir das Vergnügen eine komplette Region, die durchgängig verschnörkelt und verspielt daherkommt, genießen zu dürfen. Dabei ist der hier zu begutachtende „Sizilianische Barock“ noch eine Spur anders, als seine Geschwister auf dem Festland und wahrscheinlich macht das den eigentlichen Unterschied aus. Wie schon erwähnt, gab es durch das schreckliche Erdbeben von 1693 hier die Chance komplett von vorne anzufangen und ganze Städte in dem damals auf dem Festland aufkommenden Baustil zu errichten. Es muss eine wilde Aufbruchsphase gewesen sein und eine Chance für zahlreiche junge Architekten, die in Rom ihr Fach gelernt hatten und sich hier auf der Insel, fern des Zentrums und abseits der nervtötenden Debatten austoben konnten. Dementsprechend fortschrittlich und offen wirken die Arrangements der meisten Städte im „Val di Noto“. Aber auch in fast jeder anderen Stadt Siziliens finden sich vorzügliche und herzensöffnende Beispiele dieses lebensbejahenden Architekturstils.








Damit kommen wir zu Gela. Auch um den Eindruck, dass hier einseitige Berichterstattung zu Sizilien stattfinden würde zu vermeiden, möchte ich ein paar Worte zu dieser Stadt verlieren. Denn Gela, soviel ist sicher, gehört keinesfalls zu den schönsten Ecken der Insel. Nein, nachdem das vielbesungene „Val di Noto“ mit Ragusa endet, machen die Städtchen wieder einen normaleren süditalienischen Eindruck. Gela hat es dagegen noch ein wenig schlimmer getroffen. Denn hier ist nicht nur ein größeres Zentrum der expansiven Landwirtschaft sondern auch das der Erdölraffinerie zu finden, und beides führt zu einem eher mittelhübschen Erschienungsbild. Doch darauf möchte ich gar nicht hinaus. Was ich bei Gela beeindruckend fand, ist ein Umstand der weit zurück in der Geschichte liegt. Auch Gela war einst in grauen Vorzeiten, dass was man hierzulande häufiger war: „…eine der bedeutendsten griechischen Städte auf Sizilen…“. Doch dann verbündete man sich mit den falschen Mächten und wurde erst von den Kathagern (405 v.Chr.) erobert, geplündert und zerstört, und dann ein gutes Jahrhundert später von den Mamertinern (282 v.Chr.) restlos zerstört. Soweit so üblich in diesen Zeiten. Was mich aber aufmerken ließ, war, dass diese Stadt an einem derart siedlungsgünstigen Ort tatsächlich nicht wieder auflebte. Sie blieb verschwunden. Für knapp anderthalb Jahrtausende. Erst im Jahre 1233 beschloss ein gewisser Friedrich II., dass das doch eigentlich ein schicker Platz für eine Stadt wäre und nannte sie voll überschäumender Originalität „Terranova di Sicilia“. Weitere sieben Jahrhunderte brauchte es bis man sie wieder in den 30ern des 20. Jahrhunderts in Gela umtaufte und warum das gerade zu dieser Zeit geschah, ergründen wir im nächsten Abschnitt.

Es war hoch oben in den Bergen der Madonie. Wir waren gerade bei Lucia angekommen, einer wackeren Frau, die quasi im Alleingang hier ein totes Dorf reanimiert hatte und sich rührend um etliche krebskranke Olivenbäume kümmerte. Wir machten einen kleinen Rundgang bei dem sie uns die Farm zeigte, unter anderem auch die alte Ölmühle. Mit abschätzigen Blick wies sie kurz auf die Inschriften in der Mauer und meinte schnippisch: „Da seht ihr was das für Vorbesitzer waren! Da, die faschistischen Zahlen!“ Ich sah hin und sah nur römische Zahlen. Ich war verwirrt und ließ diese Bemerkung aber erstmal so stehen. Später begriff ich, dass die Phase der Italianisierung unter Mussolini in Sizilien enorme Blüten getrieben hatte. So blieb es nicht allein bei der Umbenennung von Orten und Straßen, im verzweifelten Versuch sich in der Sonne der vergangenen Größe des Römischen Reichs zu sonnen, gewannen auch deren Ziffern wieder an Geltung. Natürlich konnte man nicht gänzlich auf diese minderwertigen neumodischen Zahlen verzichten, doch als fascista der etwas auf sich hielt, versuchte man natürlich so oft es irgend ging auf die reinrassigere Variante an Nummern zurückzugreifen. Übrigens, auch die Tatsache, dass die meisten italienischen Vereine heute „Calcio“ im Namen haben, und nicht wie vorher „Football“, geht auf diese unrühmliche Zeit zurück.



Kommen wirnun zu einem freundlicheren Thema, kommen wir zur Oper, genauer zum Teatro Massimo in Palermo. Denn obwohl der Titel „Teatro“ etwas anderes suggeriert, handelt es sich hierbei um eines der eindrucksvollsten Opernhäuser in dem ich jemals das Vergnügen hatte, zu Gast zu sein. Bei Norwich erfuhr ich, dass sich Palermo schon vor diesem gigantischen Gebäude (1897 eingeweiht und zu diesem Zeitpunkt mit 3200 Plätzen das größte Opernhaus Italiens) einige der größten Bühnen Europas gönnte noch bevor es ein richtiges Krankenhaus hatte. Besser kann man Süditalien meines Erachtens in einem Satz schwerlich beschreiben. Das Opernhaus steht mit seiner gesamten massigen Zierlichkeit für vieles was schief lief in Sizilien. Nach einer „provisorischen Schließung“ 1974 aufgrund baulicher Mängel blieb das Teatro Massimo wegen korrupter, mafioser Baupolitik über 20 Jahre lang geschlossen. Man verharre an dieser Stelle einen Moment und lasse sich diesen Fakt auf der Verständniszunge zergehen: In dieser Stadt gab es über zwei Jahrzehnte keine Opernaufführung. In Berlin, Kopenhagen oder Dublin mag das angehen, aber in Italien? In Sizilien? Erst 23 Jahre später eröffnete man das das Haus zu seinem 100-jährigen Bestehen und seitdem gilt dieses Gebäude als eines von vielen Symbolen der „politischen und kulturellen Wiederauferstehung“ der gepeinigten Insel.

Legenden von Stadt-, Staats- und Völkergründungen gehören erfahrungsgemäß zu den unterhaltsameren Beiträgen des historischen Boulevards und so schaue ich immer wieder gern vorbei um mich mit einem munteren Schwank einzustimmen. Im Falle Tunesiens stand nun logischerweise schillernd, blinkend und alles andere überstrahlend Karthago im Vordergrund. Denn wenn ich ehrlich bin, verband ich außer Harissa und Couscous nicht viel mehr mit dem kleinen nordafrikanischen Land. Die Legende jedenfalls weiß zu berichten, dass einst die phönizische Prinzessin Elissa (bei den Römern als Dido bekannt), die Tochter des tyrischen Königs Mutto vor ihrem machtgierigen Bruder floh und über Zypern an der nordafrikanischen Küste im Golf von Tunis landete. Der ortsansässige Numidierkönig war so frei ihr Land zu versprechen, und zwar so viel wie sie mit einer Kuhhaut umspannen könne. Elissa/Dido schnitt daraufhin die Kuhhaut in hauchdünne Streifen, legte sie aneinander und konnte so ein größeres Stück Land markieren als der Numidierkönig höchstwahrscheinlich erwartet hatte. Dieser Küstenstreifen bildete, man ahnt es schnell, die Keimzelle des späteren Karthagos. Da solche Mythen sich immer etwas schwer tun ohne Krawall zu enden, muss sich Elissa/Dido natürlich später selbst auf einem Scheiterhaufen opfern. Um der Stadt Wohlstand zu garantieren. Klar, da gibt es ja sonst kaum andere Möglichkeiten um dies zu gewährleisten. Es gibt natürlich auch noch eine etwas gehaltvollere Version, um ihren Tod zu erklären. Angeblich hätte irgendwann Aeneas, neben zahlreichen anderen Funktionen auch Stammvater der Römer, in Karthago vorbeigeschaut. Es kommt wie es kommen muss: Elissa/Dido verliebt sich in ihn. Doch Jupiter befiehlt Aeneas schließlich aus nicht näher genannten Gründen abzureisen. Darauf reagiert Elissa/Dido schnell mit der einzig denkbaren Reaktion: Sie wirft sich selbst auf einen Scheiterhaufen. Natürlich nicht ohne zuvor in epischen Ausmaß Rache zu schwören. Und schwups, da wäre sie, die Grundlage für den späteren Konflikt zwischen Rom und Karthago.
Und noch eine Frage kam in mir auf als ich mich so langsam mit meiner neuen Heimat beschäftigte. Die hiesige Religion spiegelt sich oftmals auch auf den Nationalflaggen der involvierten Staaten wieder. Den Halbmond verbindet man gemeinhin mit dem Islam wie das Christentum mit dem Kreuz. Als wir nun in Palermo standen und zufrieden registrierten, dass wir exakt mit der Mondsichel einreisten, die auf der tunesischen Flagge zu sehen ist, bemerkten wir, dass auf allen, den Halbmond verwendenden Flaggen, ein abnehmender Mond verwendet wird. Das ist höchstwahrscheinlich kein Zufall und hat einen triftigen Grund. Diesen gilt es unter anderem in den nächsten Wochen herauszufinden.

Entdecke mehr von Viva Peripheria
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.